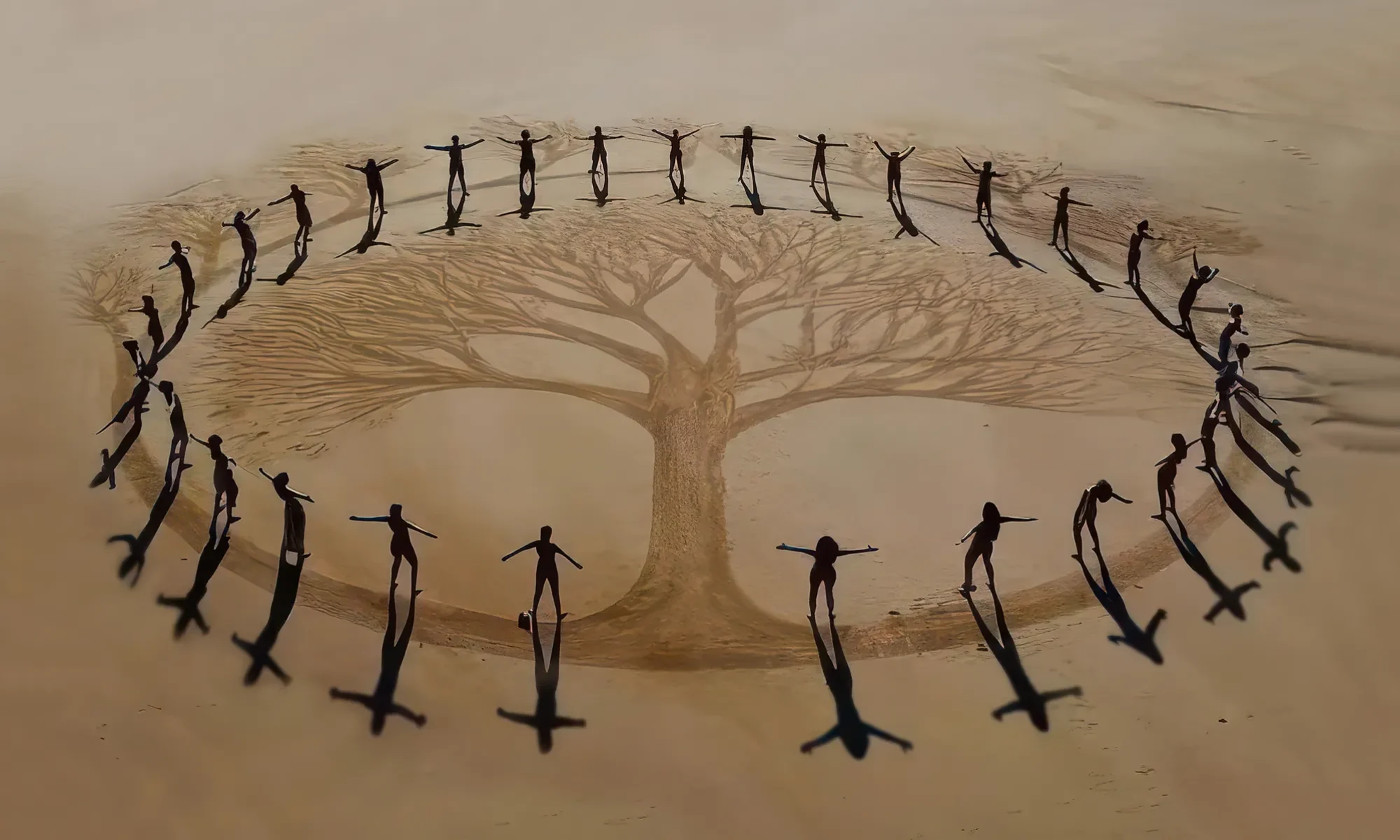– Ausarbeitung –
Dr. Jörg D. Krämer
WD 1 3010 – 038/08
2008 Deutscher Bundestag
– Zusammenfassung –
Im Rahmen der Konferenz im Hotel Rittersturz bei Koblenz vom 8. – 10. Juli 1948 diskutierten die Ministerpräsidenten der drei Westzonen die sog. „Frankfurter Dokumente“, in denen die Westalliierten Vorgaben für die Gründung eines westdeutschen Staates gemacht hatten, nicht ohne deutliche Kritik zu äußern und eigene Vorschläge zu unterbreiten. Den Ministerpräsidenten war bereits vor der Konferenz bewusst, dass angesichts der aktuellen Situation der Rückübertragung von Souveränitätsrechten an die Deutschen in den Westzonen Vorrang vor der staatlichen Einheit der Nation zu geben war. Nach den Erfahrungen der ersten und letzten gemeinsamen Ministerpräsidentenkonferenz in München 1947 verzichteten die westdeutschen Ministerpräsidenten auf Einladungen an Vertreter der sowjetisch besetzten Zone und zementierten damit die Abkehr von gemeinsamen ost- und westdeutschen Verhandlungen über die Zukunft Deutschlands, obwohl die Westalliierten dies ausdrücklich offen gehalten hatten.
Die Rittersturzkonferenz war gleichwohl bemüht, zumindest symbolisch, beispielsweise durch die Wahl des Tagungsortes oder die Hinzuziehung einer Westberliner Vertreterin, und begrifflich, durch eine ungewöhnliche staatsrechtliche Terminologie, die Teilung Deutschlands nicht zu präjudizieren. So entschied man sich bewusst für Koblenz als Tagungsort in der französischen Zone, um den Anspruch der Länder der französischen Zone auf Zugehörigkeit zur amerikanischen und britischen Zone („Bizone“) zu unterstreichen. Immer wieder betonten alle Teilnehmer, dass man an der Einheit der Nation festhalten wolle und diesem langfristigen Ziel durch den provisorischen Charakter der „Verfassungsgebenden Versammlung“, der „Verfassung“ und der „Staatsgründung“ Ausdruck verleihen wolle. So einigte man sich auf einen „Parlamentarischen Rat“ anstelle einer „Verfassungsgebenden Versammlung“, auf ein „Grundgesetz“ anstelle einer
„Verfassung“ und ein „Provisorium“ anstelle einer Weststaatsgründung.
Die späteren Entscheidungen des Parlamentarischen Rates verwässerten die Absichten der Ministerpräsidenten hinsichtlich des provisorischen Charakters deutlich.
Inhalt
1. Einleitung
2. Gesamtsstaatliche Aspekte der Konferenz
2.1. Der Tagungsort
2.2. Die Einladungen
2.3. Die Frage der Länderneugliederung
2.3.1. Exkurs: Gebietsansprüche im Westen Deutschlands
2.4. Begriffe
2.4.1. „Parlamentarischer Rat“ statt „Verfassungsgebende Versammlung“
2.4.2. „Grundgesetz“ statt „Verfassung“
2.4.3. „Provisorium“ statt „Staatsgründung“
3. Die Koblenzer Beschlüsse und ihre gesamtstaatlichen Folgen
1. Einleitung
Nachdem es den Vier Mächten (UdSSR, USA, Großbritannien und Frankreich) auf der Konferenz des Rates der Außenminister vom 25. November bis 15. Dezember 1947 nicht gelungen war, zu einheitlichen Antworten auf drängende Fragen über die Zukunft Deutschlands zu gelangen, entschieden sich die Westalliierten zu einer Konferenz ohne Beteiligung der UdSSR, der sog. Londoner Sechs-Mächte-Konferenz. Die westlichen Siegermächte – allen voran die USA – waren nunmehr entschlossen, die Konsequenzen aus dieser Entwicklung zu ziehen und dem wirtschaftlichen und politischen Aufbau in den Westzonen Vorrang vor einer staatlichen Einheit Deutschlands zu geben.
Am 23. Februar 1948 kamen in London Vertreter Großbritanniens, der USA und Frankreichs mit Vertretern Belgiens, Luxemburgs und der Niederlande zu einer gemeinsamen Konferenz zusammen. Aus Rücksicht auf die UdSSR fand die Sechs-Mächte-Konferenz formal „nur“ auf Botschafterebene statt. Die mitunter kontroverse und schwierige Auseinandersetzung in London fand ihren Niederschlag auf dem „Umweg“ über die „Londoner Empfehlungen“ in den sog. „Frankfurter Dokumenten“, drei Schriften, die den Ministerpräsidenten der Westzonen durch die drei Militärgouverneure am 1. Juli 1948 in Frankfurt überreicht wurden. Darin waren Aufforderungen zur Schaffung einer künftigen deutschen Verfassung föderalen Typs durch Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung bis zum 1. September 1948 (Dokument I), Grundzüge für eine Überprüfung der Ländergrenzen bzw. Grundzüge einer Länderneugliederung (Dokument II) und Grundzüge der künftigen Beziehung zwischen alliierter Besatzungsbehörde und deutscher Regierung (Dokument III) formuliert.
Die Westalliierten wollten die Weichen für die politische Struktur stellen und ein Verfahren für die Gründung eines Weststaates festlegen. Die Ministerpräsidenten erbaten sich für eine Antwort Zeit, um zu einer gemeinsamen politischen Linie zu gelangen.
„Ende der Besatzungsherrschaft“ und „Einheit der Nation“, so kurz könnte man die beiden Grundanliegen deutscher Politik in den Jahren 1947/1948 zusammenfassen. Die weltpolitische Lage, das war den Konferenzteilnehmern im Hotel Rittersturz bewusst, ließ das Ziel der Einheit der Nation augenblicklich eher unrealistisch erscheinen. Neben dem bereits erwähnten Dissens zwischen den Westalliierten und der UdSSR, der sich auch in einem Dissens zwischen ost- und westzonalen Länderchefs niederschlug, sind noch die Währungsreform und die Berlin Blockade zu nennen – letztere fand ihren Höhepunkt während der Rittersturzkonferenz. Darüber hinaus hatte die UdSSR am 20. März 1948 den gemeinsamen Alliierten Kontrollrat in Berlin verlassen.
Die Ministerpräsidenten hatten die Übergabe der „Frankfurter Dokumente“, in Verbindung mit Äußerungen von britischer und französischer Seite, als Aufforderung für kritische Einwände und Gegenvorschläge aufgefasst – ein wahrgenommener Gestaltungsspielraum, den ihnen die Westalliierten eigentlich nicht zugedacht hatten.
Die vorliegende Ausarbeitung konzentriert sich ausschließlich auf die gesamtstaatlichen Aspekte der Konferenz. Wesentliche Konfliktpunkte der Westalliierten und der Ministerpräsidenten in Fragen des Besatzungsstatuts, der ökonomischen Zukunft oder anderer, nicht gesamtstaatlicher Aspekte, werden ausgeklammert.
2. Gesamtstaatliche Aspekte der Konferenz
2.1. Der Tagungsort
Bereits vor der gescheiterten Außenministerkonferenz im November/Dezember 1947 hatten die Amerikaner deutsche Politiker über den Plan zur Errichtung eines westdeutschen Staates unterrichtet; dabei blieb offen, ob ein solcher westdeutscher Staat mit oder ohne die Länder der französischen Zone errichtet werden könnte. Frankreich war – nachdem sich die britische und amerikanische Zone bereits 1946 zur Bizone zusammengeschlossen hatten – erst auf der Außenministerkonferenz im Herbst 1947 bereit, einer Fusion der drei westlichen Besatzungszonen zu einer „Trizone“ zuzustimmen, stellte dafür aber Bedingungen: Dazu gehörten u. a. die Anerkennung der Abtretung des Saargebiets an Frankreich und eine ausgedehnte Besatzungszeit. Hatte Frankreich ursprünglich das Ziel verfolgt, Deutschland in souveräne Einzelstaaten aufzuteilen, so war die französische Regierung nunmehr bereit, einem lockeren Staatenbund zuzustimmen, dessen Hauptgewicht bei den Ländern liegen sollte. Vor diesem Hintergrund ist der Tagungsort Koblenz nicht zufällig gewählt worden: Die Zusammenkunft aller westdeutschen Länderchefs in Koblenz (damals Sitz der rheinland-pfälzischen Landesregierung und Teil der französischen Zone) sollte ein Zeichen für die Zugehörigkeit der französischen Zone zum westalliierten Teil des besetzten
Deutschlands und zu einem möglichen westdeutschen Staat sein. Entsprechend begrüßte der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Peter Altmeier, die Gäste: „Ich brauche Ihnen nicht besonders zu versichern, mit welchen Gefühlen unser Volk die Tatsache der Einberufung dieser Konferenz in die französische Zone aufgenommen hat, weil dadurch die Länder der französischen Zone aus ihrer Isolierung herausgetreten und zusammen mit den acht Ländern der Bizone zu gemeinsamer Zukunftsarbeit verbunden worden sind.“
In der gleichen Rede machte Altmeier auch deutlich, dass „an diesem Tisch immer noch Plätze unbesetzt sind, weil die Verhältnisse, auf die wir zu unserem tiefen Bedauern keinen Einfluss haben, eine Zusammenkunft aller Länder in dieser Stunde noch nicht ermöglicht haben“. Damit spielte Altmeier auf das Fehlen der Vertreter der Ostzone an.
2.2. Die Einladungen
Vermutlich um den Erfolg der Verhandlungen nicht zu gefährden, verzichteten die Ministerpräsidenten auf die Einladung ostdeutscher Vertreter, obwohl eine solche Einladung durch die Militärgouverneure der Westzonen ausdrücklich freigestellt worden war und sogar im Vorfeld gewünscht wurde. Hätten die Ministerpräsidenten der drei Westzonen sich für eine Beteiligung sowjetzonaler Ministerpräsidenten entschieden, hatten die Westalliierten für diesen Fall eine Kontaktaufnahme mit der Sowjetischen Militäradministration vorgesehen.
Eine Beteiligung ostdeutscher Vertreter hätte die formale Geltung der Frankfurter Dokumente für ganz Deutschland unterstrichen. Die negativen Erfahrungen der Münchener Konferenz ein Jahr zuvor dürfte die Entscheidung gegen eine Beteiligung von Vertretern aus der SBZ maßgeblich beeinflusst haben.
Von dieser ersten und zugleich letzten gemeinsamen Ministerpräsidentenkonferenz in München im Juni 1947 zogen sich die ostzonalen Länderchefs geschlossen zurück, was der bayerische Ministerpräsident Ehard als vorweggenommenen Vollzug der deutschen Teilung bewertete. Die Entscheidung gegen die Einladung und damit für eine „westzonale“ und nicht gesamtstaatliche Konferenz auf dem Rittersturz lag also bei den Ministerpräsidenten der drei Westzonen.
Unter den Gästen befand sich außerdem auch die amtierende Oberbürgermeisterin von Berlin, Louise Schröder (SPD), die von Ministerpräsident Altmeier „in unserer Mitte als Gast“ begrüßt wurde. Louise Schröder folgte einer einstimmig beschlossenen Einladung der westdeutschen Ministerpräsidenten, hatte aber nur beratende Stimme. Denn tatsächlich war Louise Schröder nicht als offizielle Vertreterin Berlins, sondern als Gast anwesend. Louise Schröder nutzte ihre Begrüßung u. a. zu einem Plädoyer für eine gesamtstaatliche Perspektive für Berlin: „Eins aber wollen wir als Berliner: verbunden bleiben mit unserem großen deutschen Staat, verbunden bleiben mit dem deutschen Volk in seiner Gesamtheit.“ In ihrem Schlusswort appellierte Schröder erneut an die Konferenzteilnehmer, „…dass nichts Endgültiges geschaffen wird, sondern erst dann eine
Entschließung gefasst wird, wenn Berlin mit den übrigen Zonen wieder zu einer Einheit gekommen ist.“
Obwohl es sich bei der Rittersturzkonferenz um eine Konferenz der Ministerpräsidenten handelte, waren auch Parteivertreter von CDU, CSU und SPD anwesend, die ihren Teil zu Verlauf und Ergebnis der Konferenz beitrugen, ohne dass ihnen offiziell Zutritt zur Konferenz gewährt worden war. Am Vortag der Rittersturzkonferenz kamen der SPD-Parteivorstand und die SPD-Ministerpräsidenten auf Jagdschloss Niederwald zu einer Vorbesprechung zusammen. Die CDU-Vertreter Altmeier, Arnold, Bock und Wohlleb besprachen sich ebenfalls am Vortag unter dem Vorsitz Adenauers.
Mit Blick auf die gesamtstaatlichen Aspekte der Konferenz soll auch hier darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den anwesenden Parteivertretern ausschließlich um Vertreter aus den Westzonen handelte: Konrad Adenauer (CDU), Erich Ollenhauer (SPD), August Haußleiter (CSU) und Otto Schefbeck (CSU). Der Bayerische Ministerpräsident Ehard (CSU) beurteilte die Anwesenheit der Parteivertreter wie folgt: „…dass während der Koblenzer Konferenz die Möglichkeit bestand, einen Gedankenaustausch mit den gleichzeitig auf dem Rittersturz anwesenden Vorsitzenden der großen Parteien zu pflegen, hat nicht unwesentlich zur Herstellung jener einmütigen Stellungnahme der Ministerpräsidenten beigetragen. Es muss festgestellt werden, dass es sich hier um eine durchaus produktive, der Sache dienliche Anteilnahme der maßgebenden Parteien handelte, deren Haltung für die Gestaltung der deutschen Frage von entscheidender Bedeutung ist.“
2.3. Die Frage der Länderneugliederung
Am Abend des ersten Verhandlungstages auf dem Rittersturz hatten sich bereits einige grundlegende Übereinstimmungen in den Positionen der Ministerpräsidenten ergeben.
Unter gesamtstaatlichen Aspekten ist u. a. der Konsens über das weitere Vorgehen in Fragen der Neugliederung der Ländergrenzen zu erwähnen. Dieser wurde als eine rein deutsche Angelegenheit gewertet und sollte von einer gesamtdeutschen Perspektive aus angegangen werden. Ein abschließender Reformvorschlag blieb somit aus. Stattdessen ergab sich am Ende der Konferenz eine Mehrheit für die Befassung des „Parlamentarischen Rats“ mit der Länderneugliederung.
Dieser Zurückstellung der Länderneugliederung lagen zwei wesentliche gesamtstaatlich motivierte Befürchtungen zu Grunde: Einerseits befürchtete man, dass eine Reform der Ländergrenzen im aktuellen Zustand der Besatzung einen zu starken Einfluss der Besatzungsmächte bedeute und die innerstaatlichen deutschen Gesichtspunkte damit in den Hintergrund treten könnten.
Andererseits hegten die Ministerpräsidenten die Befürchtung, dass vor allem die Reform der Ländergrenzen im südwestdeutschen Raum eine langwierige Auseinandersetzung der betroffenen Länder untereinander und mit der französischen Besatzungsmacht zur Folge hätte, was eine Vereinigung der französischen Zone mit der Bizone verzögern würde und aus gesamtstaatlicher Perspektive nicht wünschenswert sei. Das Gespenst einer Weststaatsgründung ohne Beteiligung der französischen Zone spukte immer noch in den Köpfen der Beteiligten, zumal US-Amerikaner und Briten einen solchen Schritt noch wenige Wochen zuvor als Möglichkeit in Erwägung gezogen hatten. Dies ging vor allem auf den amerikanischen Wunsch nach zügiger Staatsgründung zurück.
In der Diskussion über die Länderneugliederungen spielte der gesamtdeutsche Aspekt auch über die beiden genannten Aspekte hinaus eine nicht unerhebliche Rolle. Wenn es galt, eigene regionale Interessen zu verteidigen, setzten die Ländervertreter in ihrer Argumentation gerne auf eine gesamtdeutsche Karte: Wegen der Gefahr der Isolierung des Ruhrgebietes und der daraus folgenden Gefahren für Gesamtdeutschland sollte beispielsweise Nordrhein-Westfalen nicht verändert werden; Rheinland/Pfalz sollte beibehalten werden, weil die Franzosen sonst leichteres Spiel für die Gründung eines linksrheinischen Rheinland-Staates hätten haben können – eine Auflösung des Landes hätte darüber hinaus Rückwirkungen auf den Bestand von Nordrhein-Westfalen (Ruhrgebiet!); Rheinland/Pfalz hatte die Rückführung des Saargebiets als „nationalpolitische Aufgabe“ bezeichnet und hoffte in diesem Zusammenhang selbst auf einen möglichen Gebietszuwachs; Württemberg-Baden begründete die Schaffung eines großen Südwest-Staates gesamtdeutsch, da auf diese Weise ein ausgewogener Föderalismus zustande käme; ihre gesamtdeutsche Aufgabe als Handels- und Hafenstädte führten Bremen und Hamburg als Grund für ihre Selbstständigkeit an.
2.3.1. Exkurs: Gebietsansprüche im Westen Deutschlands
Die Notwendigkeit zur Schaffung einer handlungsfähigen deutschen Exekutive, wie sie von der Konferenz auf dem Rittersturz geplant war, hatte auch gesamtstaatliche Hintergründe im Kontext vorhandener Gebietsansprüche im Westen Deutschlands: Frankreich hatte Anspruch auf den badischen Hafen Kehl erhoben, Dänemark unterstützte Tendenzen in Schleswig-Holstein zur Bildung eines eigenständigen Landes Südschleswig, und die Beneluxstaaten hatten Gebietsforderungen an der Westgrenze erhoben. Um die deutschen Interessen gegenüber diesen Forderungen tatsächlich vertreten zu können, war ein rascher Prozess notwendig, der zu einer handlungsfähigen deutschen Exekutive, also einer kurzfristigen Rückübertragung von Souveränitätsrechten führte. Der westdeutschen Politik war klar, dass diese Territorialfragen – im Gegensatz zu Territorialfragen im Osten Deutschlands – möglicherweise im deutschen Interesse gelöst werden könnten. Auch das mag ein gesamtstaatlicher Aspekt für den durch die Ministerpräsidenten auf dem Rittersturz eingeschlagenen Weg gewesen sein.
2.4. Begriffe
Aus dem Dilemma des kurzfristigen Ziels der Rückübertragung von Souveränitätsrechten in den Westzonen und der daraus abzusehenden langfristigen Folgen für die Einheit der Nation versuchten die Ministerpräsidenten der Westzonen durch eine eigenwillige
Begrifflichkeit zumindest verbal zu entkommen. Reinhold Maier schreibt in seinen Memoiren zur Rittersturzkonferenz, es sei eine „schauderhafte Gewissensqual“ gewesen; und zur Lage der Deutschen (in Anlehnung an Hegel): „Deutschland ist der Widerspruch, dass es ein Staat sein muss, aber nicht sein kann.“ Man hatte sich im Vorfeld der Konferenz im Prinzip damit abgefunden, der Ablösung der Besatzungsherrschaft den Vorrang vor der Einheit der Nation zu geben, nun versuchte man, diese politische Festlegung in einer unüblich juristisch-staatsrechtlichen Terminologie möglichst zu verschleiern. Die damals bedeutende Zeitschrift „Die Gegenwart“ bemerkte dazu treffend: „Die Ministerpräsidenten wollen eine genau abgegrenzte stellvertretende Macht auf sich nehmen und nach bestem Wissen und Gewissen anwenden, aber sie wünschen nicht, sich mit dem Anschein einer souveränen Macht bekleidet zu sehen.“ Die Bemühungen, durch Sprachakrobatik staatsrechtlich gesicherte Formulierungen möglichst zu umgehen, um damit den provisorischen Charakter des zukünftigen Gebildes und seines Zustandekommens zu betonen, werden im Folgenden anhand einiger wesentlicher Begriffe aufgezeigt.
2.4.1. „Parlamentarischer Rat“ statt „Verfassungsgebende Versammlung“
Wichtigster Verhandlungsgegenstand in Koblenz, so Rainer Volk, war das in Dokument I enthaltene Recht der Ministerpräsidenten auf Einberufung einer Verfassungsgebenden Versammlung.
Die Unionsvertreter einigten sich bereits in der Vorbesprechung zur Rittersturzkonferenz unter dem Vorsitz Konrad Adenauers darauf, eine „Verfassungsgebende Versammlung“, wie sie in den Frankfurter Dokumenten enthalten war, abzulehnen und stattdessen einen „Parlamentarischen Rat“ durch die Länderparlamente wählen zu lassen. Dieser „Parlamentarische Rat“ sollte die „vorläufige organisatorische Grundlage für die Zusammenfassung der drei Zonen schaffen, ein Wahlgesetz für ein künftiges vom Volke gewähltes Parlament vorbereiten und überhaupt die Interessen der deutschen Bevölkerung gegenüber den Besatzungsmächten zur Geltung bringen“. Deutliche Worte fand auch der liberale Ministerpräsident von Württemberg-Baden, Reinhold Maier, in seiner Eingangsrede: „Diese absolute Übereinstimmung scheint mir zunächst in der Tatsache, dass niemand der Herren einen Weststaat bzw. eine Verfassungsgebende Nationalversammlung wünscht.“
Auch vor dem Hintergrund, dass man sich auf die Bildung eines Provisoriums verständigen wollte, schien es für die Konferenzteilnehmer zu Recht als ein Widerspruch, eine „Verfassungsgebende Versammlung“ einzuberufen, das Ergebnis aber nur „Provisorium“ zu nennen. In dieser Logik lag auch die Entscheidung der Ministerpräsidenten, die „Körperschaft“, die das „Provisorium“ ausarbeiten sollte, in einer indirekten Wahl einzuberufen, also durch die Länderparlamente und nicht, wie von den Westalliierten vorgesehen, durch eine direkte Wahl. Die Frage des Zustandekommens des „Gremiums“, das an Stelle einer Verfassungsgebenden Versammlung gewählt werden sollte, war Gegenstand ausgiebigster Debatten.
2.4.2. „Grundgesetz“ statt „Verfassung“
In den Memoiren Reinhold Maiers liest man zur Entstehungsgeschichte des Begriffs „Grundgesetz“ auf der Rittersturzkonferenz: „Verfassung gehört [..] zu den Requisiten eines regelrechten Vollstaates. Einen solchen wollten wir aber gerade nicht. Da kam irgendjemand mit dem Wort „Grundgesetz“ anstelle von Verfassung. Heute geht dieses Wort jedermann absolut selbstverständlich über die Lippen. Damals war es aber vielleicht in engsten Fachkreisen bekannt, aber sonst ungebräuchlich. Wie vom Himmel gefallen stand das Wort vor uns und bemächtigte sich unserer Köpfe und Sinne, gewiss nicht der Herzen. Machen wir doch ein Grundgesetz, das keinen Vollstaat voraussetzt!
Das neue jungfräuliche Wort vermochte so schön trügerisch von der Realität jener Tage wegzuführen.“
Die „Realität dieser Tage“ war die Erkenntnis, dass die Spaltung Deutschlands durch die Ministerpräsidenten nicht geschaffen würde, sondern vielmehr schon vorhanden war. „Trügerisch“ war man dennoch bemüht, der Einheit der Nation symbolisch und begrifflich eine Perspektive zu geben. Das sollte sich auch in der Vorläufigkeit der zu schaffenden „Verfassung“, in deren provisorischem Charakter, widerspiegeln. Max Brauer (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, brachte diesen Gedanken bereits am ersten Konferenztag ein, indem er die Idee einer Präambel ins Spiel brachte, die die Vorläufigkeit einer Verfassung betonen sollte.
Mit der Entscheidung für ein „Grundgesetz“ war auch eine Entscheidung gegen einen Volksentscheid vorbestimmt. Die Ministerpräsidenten erklärten, dass ein Volksentscheid dem Grundgesetz ein Gewicht verleihen würde, das nur einer endgültigen Verfassung zukommen sollte. In der Mantelnote zu den Koblenzer Beschlüssen weisen die Ministerpräsidenten in diesem Zusammenhang zudem darauf hin, dass eine deutsche Verfassung erst dann geschaffen werden könne, „wenn das gesamte deutsche Volk die Möglichkeit besitzt, sich in freier Selbstbestimmung zu konstituieren“.
Carlo Schmid definierte das „Grundgesetz“ als für die „einheitliche Verwaltung des Besatzungsgebiets der Westmächte“ gedacht. Also nicht „Regierung“, sondern „Verwaltung“. Rainer Volk hält es für „wichtig, dass eben nicht von ‚Regierung’ die Rede ist. Dieser Unterschied ist wichtig, weil in Rüdesheim später die Wortbedeutung in ihrer Deutlichkeit verwischt wird.“
2.4.3. „Provisorium“ statt „Staatsgründung“
Die Meinungslage zu Beginn der Konferenz auf dem Rittersturz war vor allem auf Seiten der SPD-Vertreter uneinheitlich. Die SPD-Länderchefs Max Brauer (Erster Bürgermeister Hamburgs) und Wilhelm Kaisen (Bürgermeister von Bremen) waren Befürworter der Staatsgründung, konnten sich eine Verfassungsgebende Versammlung vorstellen, legten aber Wert darauf, dass eine einheitliche Regelung wichtiger sei als das Beharren auf diesen Standpunkten. Der hessische Ministerpräsident Stock (SPD) äußerte ebenfalls seine Zustimmung zu einer Staatsgründung, lehnte aber eine Verfassungsgebende Versammlung ab, weil deren Einberufung ihm zu zeitaufwendig schien. Die SPD-Länderchefs Hinrich Wilhelm Kopf (Niedersachsen) und Hermann Lüdemann (Ministerpräsident von Schleswig-Holstein) waren gegen die Staatsgründung und vertraten mit dieser Position die Parteilinie des SPD-Parteivorstands. Am 29. Juni 1948 hatte dieser in einem Beschluss festgehalten, dass die Londoner Empfehlungen ungeeignet seien, die Souveränität Deutschlands wiederherzustellen, die Vorschläge liefen vielmehr auf ein weiteres Provisorium hinaus: „Weststaatsgründung ist Verrat an den Bürgern im Osten“. Der liberale Ministerpräsident von Württemberg-Baden, Maier, hielt ebenfalls eine Staatsgründung ohne Nationalversammlung für sinnvoll. Ebenso wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Karl Arnold (CDU) begründete sein Parteifreund Lorenz Bock (Württemberg-Hohenzollern) seine Ablehnung einer Staatsgründung: „Würde man für die drei Zonen das tun, dann würde das heißen, einen Weststaat zu schaffen, und ich habe keinen Zweifel, dass die Russen sofort mit einem Oststaat antworten werden, und dann wäre das rechtlich vollzogen, was z. Zt. schon geschehen ist, nämlich die Teilung Deutschlands in ein Ostdeutschland und in ein Westdeutschland.“
Ein klares Ja zu Dokument I gab lediglich der bayerische Ministerpräsident Ehard.
Ehard (CSU) argumentierte, dass, wenn man sich nicht auf die Bedingungen des Ostens für den Erhalt der deutschen Einheit einlassen wolle, die Gründung eines westdeutschen Teilstaates erforderlich sei.
Carlo Schmid (SPD) hatte in einem Namensbeitrag für das Schwäbische Tageblatt bereits Mitte Juni 1948 mit deutlichen Worten den provisorischen Charakter einer möglichen Weststaatsgründung beschrieben: „Den Deutschen, die glauben könnten, dass wir mit dieser Formulierung einen Verzicht leisten, sei gesagt, dass ein Staat ein Staatsvolk voraussetzt und dass es ein westdeutsches Staatsvolk nicht gibt, sondern nur ein gesamtdeutsches.“ Damit nahm Carlo Schmidt eine dezidiert andere Haltung ein als der SPD-Parteivorstand und einige der SPD-Länderchefs.
In Dokument III der Frankfurter Dokumente ist nicht von „politischer“ Einheit, sondern nur von administrativer und wirtschaftlicher Einheit die Rede. Daraus schlossen einige Anwesende, dass das zukünftige Gebilde gar keine Staatsqualität haben solle. Die Diskussionen um das zukünftige staatliche Gebilde bestechen durch unpräzise Formulierungen. Der Bayerische Ministerpräsident Ehard etwa, ein hervorragender Jurist, spricht von „…irgendeiner Organisation, die über den Ländern so etwas Ähnliches wie eine Regierungsgewalt schafft.“
Es soll wohl vor allem das Verdienst Carlo Schmidts gewesen sein, dass sich die SPD und damit letztendlich auch die Rittersturzkonferenz auf ein Provisoriumskonzept verständigte.
In der Mantelnote zu den Koblenzer Beschlüssen machten die Ministerpräsidenten ihre Vorbehalte gegen eine Staatsgründung deutlich: „…unbeschadet der Gewährung möglichst vollständiger Autonomie an die Bevölkerung dieses Gebietes [der drei Westzonen] [muss] alles vermieden werden [..], was dem zu schaffenden Gebilde den Charakter eines Staates verleihen würde; […] die Ministerpräsidenten [müssen] besonderen Wert darauf legen, dass bei der bevorstehenden Neuregelung alles vermieden wird, was geeignet sein könnte, die Spaltung zwischen West und Ost weiter zu vertiefen.“
3. Die Koblenzer Beschlüsse und ihre gesamtstaatlichen Folgen
Die Koblenzer Beschlüsse wurden am 10. Juli 1948 von den elf Ministerpräsidenten der damaligen westdeutschen Länder veröffentlicht. Darin wurde festgestellt, dass die Weststaatsgründung lediglich ein Provisorium sein sollte, um einen gesamtdeutschen Staat anzustreben. Obwohl die deutsche Einheit zu dieser Zeit schon in weite Ferne gerückt war, waren sich die Ministerpräsidenten einig, dass diese Einheit weiterhin erklärtes Ziel sein sollte. Peter Altmeier (CDU) machte dies auf der Rittersturzkonferenz besonders pathetisch deutlich, als er in seiner Eröffnungsrede den in Koblenz geborenen Joseph Görres zitierte: „Was alle uns eint, ist dieselbe Liebe, die gleiche Treue, dasselbe Vaterland!“ Die Ergebnisse von Koblenz waren durch zwei gesamtstaatliche Faktoren maßgeblich geprägt: Zum einen sahen die Ministerpräsidenten keine ausreichende deutsche Souveränität für eine Staatsgründung, zum anderen wollten sie nicht die Verantwortung für die Teilung Deutschlands übernehmen. „Mit der Theorie, nur ein Provisorium zu schaffen, ließ sich sowohl die Frage der fehlenden Souveränität als auch das Problem der Verantwortung für die Teilung Deutschlands zumindest entschärfen.“
Die späteren Entscheidungen des Parlamentarischen Rates verwässerten die Absichten der Ministerpräsidenten hinsichtlich des provisorischen Charakters deutlich: Die Beschlüsse der Rittersturzkonferenz sind keine geradlinige Fortsetzung der Frankfurter Dokumente. Vielmehr sind sie in wesentlichen Punkten eine Art Gegenvorschlag (Karl Arnold). Nur verbal, in Punkt 1 der Mantelnote, akzeptieren die Ministerpräsidenten den Staatsgründungsauftrag der Alliierten, alle anderen Punkte wehren dieses Ansinnen ab. Juristisch betrachtet kommt somit etwas anderes heraus, als es die Alliierten
vorgeschlagen hatten: Ein mit einem Verwaltungs- und Organisationsstatut ausgestattetes Vereinigtes Wirtschafts– und Verwaltungsgebiet. Entsprechend enttäuscht reagierten die Alliierten, vorneweg die US-Amerikaner, hatten sie doch wesentlichen Anteil am Zustandekommen der Frankfurter Dokumente. General Clay bezeichnete die Vorschläge der Rittersturzkonferenz als „…catastrophic disregard of the seriousness of the total European situation.“ Und weiter: „…that the counterproposals of the Ministers President should be flatly rejected and they should be informed that the proposals made to them as a result of the London meeting are governmental procedures which the Ministers President have no authority to modify.“ An anderer Stelle bemerkt der „Political Advisor for Germany“, Murphy, dass die ablehnende Haltung zur Staatsgründung in der Furcht liege, mitverantwortlich für die deutsche Teilung zu sein.
„Ganz ohne Zweifel stellte die Verabschiedung des Grundgesetzes – trotz aller terminologischer Vorbehalte – den Erlass einer Verfassung dar; ebenso bedeutete die Gründung der Bundesrepublik Deutschland eben doch eine Staatsbildung. In Westdeutschland war – gemäß dem Willen der Alliierten – ein stabiler demokratischer Staat entstanden. Trotz aller Bekenntnisse zur Deutschen Einheit hatte die Rittersturzkonferenz der westdeutschen Ministerpräsidenten de facto die unaufhaltsame Teilung Deutschlands bestätigt.
Das Spannungsverhältnis zwischen Einheit und Demokratie, das die deutschen Demokraten seit 1848 gespalten hatte, wurde auf dem Koblenzer Rittersturz zum letzten Mal ausgetragen und – in der Folge – von den Alliierten zugunsten der Demokratie schieden. Die politische Großwetterlage erwies sich für die Behandlung der Deutschen Frage als bestimmend.“
(bundestag-Rittersturzkonferenz-1948)