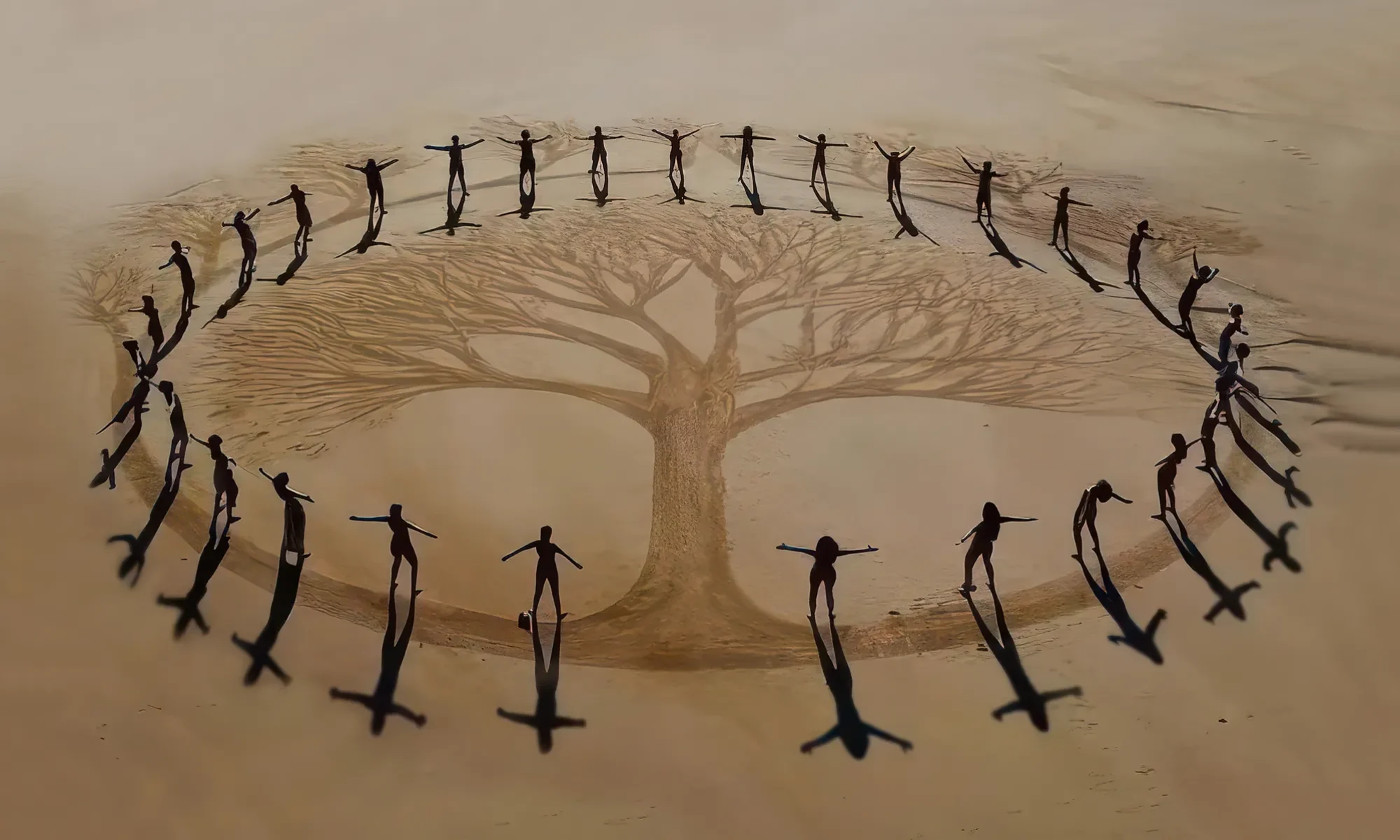I. Die Anfänge in den Deutschen Bundesstaaten
Ausgangspunkt der Entwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts in Deutschland war die Gründung des Deutschen Bundes am 8. Juni 1815. Den politischen Verhältnissen entsprechend befaßte sich hiernach freilich nicht der Bund mit der Staatsangehörigkeit, sondern jeder einzelnender nunmehr souveränen Bundesstaaten . Auf diese Weise löste die Angehörigkeit zu den Bundesstaaten als politische Gebilde die Angehörigkeit zu den Fürsten ab.
Die Entwicklung soll anhand zweier Beispiele aufgezeigt werden: Eine der ersten Regelungen erging im Jahre 1818 in Bayern; ein fortgeschrittenes Stadium repräsentiert das preußische Regelungswerk von 1842.
Das preußische Gesetz über die Untertanenschaft von 1842
Wegweisend für die weitere Entwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts war das „Gesetz über die Erwerbung und den Verlust der Eigenschaft als Preußischer Untertan, so wie über den Eintritt in fremde Staatsdienste“ vom 31. Dezember 1842. Nicht nur dessen systematische Gliederung in Erwerbs- und Verlustgründe diente der Regelung einer einheitlichen deutschen Staatsangehörigkeit später als Vorbild; auch die inhaltliche Ausgestaltung blieb lange Zeit bestimmend.
a) Der Erwerb der Untertanenschaft in Bezug auf den Erwerb der Untertanenschaft durch Geburt bekannte auch Preußen sich uneingeschränkt zum Ius-sanguinis-Prinzip: „Jedes eheliche Kind eines Preußen wird durch die Geburt Preußischer Untertan, auch wenn es im Auslande geboren ist.”
Uneheliche Kinder folgen der Mutter (§ 2). Uneheliche Kinder eines preußischen Vaters erwarben die Untertanenschaft durch Legitimation (§ 3). Während Ausländerinnen durch Verheiratung mit einem Preußen ihrerseits preußische Untertanen wurden (§ 4), hatte die Adoption für sich allein diese Wirkung nicht (§ 1 a.E. ).
Die Vorschrift des § 5 ermächtigte die Landes-Polizeibehörden zur Verleihung der preußischen Untertanenschaft durch Ausfertigung einer Naturalisationsurkunde. Allerdings sollte die Eigenschaft als Preuße gemäß § 7 nur solchen Ausländern verliehen werden, welche
1.) nach den Gesetzen ihrer bisherigen Heimat dispositionsfähig waren,
2.) einen unbescholtenen Lebenswandel geführt hatten,
3.) an dem Orte, wo sie sich niederlassen wollten, eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen fanden,
4.) an diesem Orte nach den daselbst bestehenden Verhältnissen sich und ihre Angehörigen zu ernähren imstande waren, und
5.) wenn sie Untertanen eines Deutschen Bundesstaats waren, die Militärpflicht gegen ihr bisheriges Vaterland erfüllt hatten oder davon befreit worden waren.
Das Ermessen der Behörden war also eingeschränkt. Die Verwaltungspraxis engte den Anwendungsbereich der Naturalisation noch weiter ein, indem sie – entgegen dem Wortlaut der Vorschrift, der schon die bloße Niederlassungsabsicht genügen ließ (Nr. 3) – von dem Ausländer verlangte, daß er sich bereits in Preußen niedergelassen hatte.
Dadurch wurden die Chancen eines dauerhaften Verbleibs verbessert. Die Regelungen in § 7 Nr. 3 und 4 zeigen das Anliegen, die Sozialkassen durch die Verleihung der Untertanenschaft nicht zu belasten.
Die Entstehung von Mehrstaatlichkeit stand der Naturalisation nicht zwingend entgegen, jedoch mußten die Bundesstaaten im Verhältnis zueinander darauf achten, daß es nicht zu Konflikten in Bezug auf die Militärpflicht kam (Nr. 5).
Die gleiche Wirkung wie eine Naturalisationsurkunde entfaltete gemäß § 6 die „Bestallung für einen in den Preußischen Staatsdienst aufgenommenen Ausländer“. Nach § 10 Satz 1 er- streckte sich die Verleihung der Eigenschaft als preußischer Untertan, die gemäß §§ 5 und 6 erfolgte, grundsätzlich zugleich auf die Ehefrau und die noch unter väterlicher Gewalt stehenden minderjährigen Kinder. Zusammen mit den anderen Erwerbsgründen (Abstammung, Legitimation und Verheiratung mit einem Preußen) wirkte diese Regelung auf eine einheitliche Angehörigkeit innerhalb der Familie hin.
——– o ——–
Das Staatsangehörigkeitsrecht im Kaiserreich
Das Gesetz über die Bundes- und Staatsangehörigkeit von 1870
Die deutsche Nationalversammlung von 1848 scheiterte in ihrem Bemühen, die deutsche Einheit zustande zu bringen und ein „deutsches Reichsbürgerrecht“ zu schaffen (vgl. § 132 der Verfassung vom 28. März 1849).
Mit der Gründung des Norddeutschen Bundes am 1. Juli 1867 ging dann aber die Einführung einer „Bundesangehörigkeit“ einher, welche die in den einzelnen Gliedstaaten vorgefundenen Staatsangehörigkeiten überlagerte.
Lediglich zur Herstellung eines einheitlichen Rechtszustandes innerhalb des Bundes war denn auch das „Gesetz über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit“ vom 1. Juni 1870 zunächst gedacht.
Bei der Gründung des Deutschen Reiches wurde dieses Gesetz sogleich zum Reichsgesetz „befördert“.
Am 1. Januar 1871 trat es in den Staaten des Norddeutschen Bundes sowie in Württemberg, Baden und Hessen südlich des Mains in Kraft, am 13. Mai 1871 folgte Bayern nach.
Schwierigkeiten bereitete die spätere Einführung in Elsaß-Lothringen (28. Januar 1873) und auf der Insel Helgoland (1. April 1891).
Nach dem ersten Satz des vom föderalistischen Prinzip regierten Gesetzes knüpfte die Reichsangehörigkeit an die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate an (sogenanntes Vermittlungsprinzip); jene Gebiete hatten aber keine Staatsqualität und damit auch keine eigenen Staatsangehörigen.
Während diese Probleme mit mehr oder weniger überzeugenden Konstruktionen gelöst werden konnten, sprengte der Erwerb der Kolonien völlig den Rahmen des Regelungswerkes von 1870.
An der Schaffung einer unmittelbaren Reichsangehörigkeit führte hier kein Weg vorbei.
In der Sache brachte das Gesetz, das den Terminus der „Staatsangehörigkeit“ im modernen Sinne in die deutsche Rechtssprache einführte, kaum Neuerungen.
Das war aber auch nicht die Intention des Gesetzgebers.
Vielmehr galt es „einmal, das völkerrechtliche Band, das damals allein die Angehörigen der im Norddeutschen Bund zusammengeschlossenen Staaten vereinte, entsprechend den abgeschlossenen Bundesverträgen in ein staatsrechtliches Band zu verwandeln, und es handelte sich ferner darum, allen Angehörigen des Norddeutschen Bundes ein gemeinsames Indigenat dem Auslande gegenüber zu verschaffen“.
Bei der Verwirklichung dieser „große(n) nationale(n) Aufgabe“ beschränkte das Gesetz sich darauf, die Regeln wiederzugeben, die der Mehrzahl der Bundesstaaten nach den bisherigen Einzelgesetzgebungen gemeinsam waren.
Namentlich lehnte es sich unübersehbar an das preußische Regelungswerk von 1842 an, das den letzten Stand des Partikularrechts repräsentierte.
a) Der Erwerb der Staatsangehörigkeit
In § 3 sah das Gesetz zunächst den Staatsangehörigkeitserwerb durch Abstammung vor, so daß sich das Ius-sanguinis-Prinzip spätestens jetzt in ganz Deutschland durchsetzte.
Auch die Erwerbsgründe der Legitimation (§ 4) und der Verheiratung (§ 5) wurden aus Preußen übernommen.
……..
b) Der Verlust der Staatsangehörigkeit
Auch die Mehrzahl der in § 13 des Gesetzes von 1870 aufgezählten Verlustgründe ist in ihren Grundzügen bereits von Preußen her bekannt. Militärische Interessen standen einer Entlassung aus der Staatsangehörigkeit nach der Gründung eines einheitlichen Heeres freilich nicht mehr entgegen, wenn der Betreffende die Staatsangehörigkeit eines anderen Bundesstaates erwarb (vgl. § 15).
………
Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913
Nach der Errichtung des Deutschen Reiches entwickelten sich die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse rasant fort. Mit dieser Entwicklung konnte das Staatsangehörigkeitsgesetz von 1870 auf Dauer nicht Schritt halten. Insbesondere die letzten Anknüpfungen an den Wohnsitz entsprachen nicht mehr den Anschauungen der Zeit.
Hauptkritikpunkt war der Verlustgrund des zehnjährigen Auslandsaufenthalts (§ 21). Als die Zahl derjenigen Staatsangehörigen, die aus Deutschland auswanderten, jährlich in die Hunderttausende zu gehen begann, zeigten sich die unangenehmen Begleiterscheinungen dieser Bestimmung deutlicher als je zuvor. Auswanderer, welche ihre deutsche Staatsangehörigkeit ( Reichsangehörigkeit) verloren, ohne eine neue zu erwerben, wurden vom Schicksal der Staatenlosigkeit ereilt.
Hingegen behielt seine deutsche Staatsangehörigkeit, wer eine ausländische Staatsangehörigkeit erwarb. Auch das Phänomen der Doppel- bzw. Mehrstaatlichkeit breitete sich dadurch immer mehr
aus. Weder das eine noch das andere war bei den Staaten gern gesehen. Zur Mehrstaatlichkeit bemerkte der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern, Delbrück, in den Reichstagsverhandlungen über ein neues Staatsangehörigkeitsgesetz: „(…) der Mensch kann eben nicht zween Herren dienen, und es ist unzweckmäßig, ohne zwingenden Grund – ich werde auf die Ausnahmen kommen, die unter allen Umständen empfehlenswert sind – die Zahl der Subjekts mixtes ins Ungemessene anschwellen zu lassen“.
Hinzu kam, daß der Auswanderung jetzt nicht mehr dieselbe Bedeutung beigemessen wurde wie früher. Hatte sie um 1870 noch – nicht zuletzt wegen der räumlichen Distanz – als unumkehrbar gegolten, so herrschte nun die Auffassung vor, daß die Beziehungen zum Vaterland im Ausland keineswegs abgebrochen werden müßten. Dies lag zum einen an den verbesserten technischen Möglichkeiten, in Kontakt mit der Heimat zu bleiben (Transportwege, Briefverkehr, Presse etc.).
Vor allem aber zeichnete das zwischenzeitlich erstarkte Nationalgefühl für den Wandel der Anschauungen verantwortlich. Zitat Staatssekretär Delbrück: „Das `civis Germanus sumí` hat aufgehört, ein leeres Wort zu sein. (…)
Das Bewußtsein, ein Deutscher zu sein, erschöpft sich nicht mehr in einem Bündel sentimentaler Erinnerungen“.
Dazu stand es in eklatantem Widerspruch, daß die Entscheidung über Verlust oder Fortbestand der Staatsangehörigkeit im Ausland von einer bloßen Formalität (Eintragung in die Matrikel eines Bundeskonsulats) abhing. Die Entwicklung entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Dadurch, daß das Gesetz von 1870 seine „große nationale Aufgabe“ erfüllte, büßte es seine Geltungsberechtigung teilweise auch wieder ein. Die nationale Einheit, die zur Zeit der Reichsgründung noch in den
Kinderschuhen gesteckt und daher eine behutsame Behandlung erfordert hatte, war inzwischen so gefestigt, daß sie nun sogar über territoriale Grenzen hinweg gepflegt werden konnte.
Diese Aufgabe fiel dem „Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz“ vom 22. Juli 1913 297 (RuStAG) zu, welches am 1. Januar 1914 in Kraft trat und bis zur Reform im Jahre 1999 – wenn auch mit zahlreichen Änderungen im Detail – die Hauptquelle des Staatsangehörigkeitsrechts der Bundesrepublik Deutschland bilden sollte.
Die Grundausrichtung des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts blieb weiterhin unangetastet.
Nicht zufällig fiel die Neuregelung aber mit einer Reform des Reichsmilitärgesetzes sowie des „Gesetzes, betreffend Änderungen der Wehrpflicht“ zusammen, begründete sie doch auch einen engeren Zusammenhang zwischen Militärdienst und Staatsangehörigkeit. Der Gedanke einer Verbindung von Staatsangehörigkeit und Wehrpflicht geht zurück auf die Französische Revolution, welche die Vaterlandsverteidigung zu einer Grundpflicht des Bürgers er-hob (Art. 9 der
Revolutionsverfassung von 1795).
a) Der Erwerb der Staatsangehörigkeit
An der ausschließlichen Geltung des Ius-sanguinis-Prinzips änderte sich – entgegen ursprünglicher Befürchtungen der Regierung – durch die Neufassung des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahre 1913 nichts. Dem lag eine ganz bewußte Entscheidung gegen das ius soli zugrunde. Sämtliche Anträge auf dessen Einführung – selbst einer, der nur eine abgeschwächte Form des Gebietsgrundsatzes
befürwortete – wurden in den Beratungen des Gesetzes verworfen, da sie den herrschenden Vorstellungen von der Zusammensetzung des deutschen Volkes fundamental widersprachen.
Das Staatsangehörigkeitsrecht in der Weimarer Republik
Die Regelung von 1913 erweckt in mancherlei Beziehung den Anschein, sie sei „auf den Kriegsfall geradezu zugeschnitten“ gewesen. Jedoch fehlen verläßliche Angaben darüber, inwieweit der deutsche Kaiser von den ihm eingeräumten Befugnissen – insbesondere von der Möglichkeit, sich im Ausland befindende Deutsche unter Androhung des Staatsangehörigkeitsverlustes zur Rückkehr aufzufordern (damals § 27 RuStAG) – dann im Ersten Weltkrieg Gebrauch machte.
Wichtiger ist denn auch die Erkenntnis, daß das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht aus einem so einschneidenden Ereignis wie dem Ersten Weltkrieg nahezu unverändert hervorging:
Für die Regelung der Staatsangehörigkeit verwies die Weimarer Reichsverfassung in Art. 110 Abs. 1 auf ein Reichsgesetz. Bei diesem Gesetz handelte es sich nach wie vor um das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913.
Allerdings bekam das Staatsangehörigkeitsrecht einen neuen Wirkungskreis. Der am 10. Januar 1920 in Kraft getretene Friedensvertrag von Versailles und die später mit den Erwerberstaaten geschlossenen Staatsangehörigkeits- und Optionsabkommen enthielten zahlreiche Bestimmungen über Staatsangehörigkeitsfragen im Zusammenhang mit Gebietszessionen. Infolge dessen verlor Deutschland nicht nur große Gebiete an die alliierten und assoziierten Mächte sowie an neu entstandene Staaten, sondern auch sechs Millionen Staatsangehörige und seine gesamte Kolonialbevölkerung.
Der Versailler Vertrag verbot zudem die allgemeine Wehrpflicht. Alle darauf bezogenen
Vorschriften des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes (§§ 22, 26, 32) wurden dadurch
gegenstandslos.
In der Weimarer Republik zeichnete sich auch schon ab, in welchen Punkten sich die
Grundkonzeption des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts in Zukunft einer Reform nicht würde entziehen können. Zu nennen sind hier zum einen verschiedene Anläufe, an Stelle der bisherigen Konstruktion von Reichs- und Landesangehörigkeit eine einheitliche unmittelbare Reichsangehörigkeit zu setzen.
Die Realisierung dieses Vorhabens ließ freilich noch einige Zeit auf sich warten.
Analyse: Überkommene Prinzipien des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts
Das Ius-sanguinis-Prinzip
Kein anderes Prinzip ist so signifikant für das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht wie das Ius-sanguinis-Prinzip. Seit eh und je wird die Staatsangehörigkeit in der Familie „ weitervererbt“.
Nicht einmal ergänzend dazu tritt das ius -soli in der Geschichte des
Staatsangehörigkeitsrechts in Erscheinung. Vielmehr lehnte der Gesetzgeber eine
Anknüpfung an den Geburtsort bis zuletzt ganz bewußt.
Der Grundsatz staatsangehörigkeitsrechtlicher Familieneinheit Unübersehbar prägt ferner das Bemühen des Gesetzgebers, eine einheitliche Staatsangehörigkeit in der Familie herzustellen und zu bewahren, die Geschichte des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts. Der Erwerb der Staatsangehörigkeit nach dem Abstammungsgrundsatz ist dafür nur ein Beispiel.
Das Staatsangehörigkeitsrecht unter dem NS-Regime
In der Zeit von 1933 bis 1945 verkam das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht zum Spielball der nationalsozialistischen Rassenideologie. Geradezu pervertiert wurde dabei die eigentliche Aufgabe der Staatsangehörigkeit, ein festes, dauerhaftes Band zwischen Staat und Individuum zu statuieren.
Das NS-Regime setzte das Staatsangehörigkeitsrecht gezielt dazu ein, „unerwünschte“ Personen loszuwerden, indem es das Band der Staatsangehörigkeit zu ihnen willkürlich zerschnitt. Zahlreiche Gesetze und Verordnungen aus jener Zeit zeugen von dieser Vorgehensweise. Zwar sind die meisten davon längst außer Kraft getreten. Wegen ihrer ideologischen Einfärbung können sie auch nicht als traditionsbildender Bestandteil der Geschichte des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts angesehen werden . Indirekt hat der Umgang der Nationalsozialisten mit der Staatsangehörigkeit aber großen Einfluß auf die heutige Gestalt des Staatsangehörigkeitsrechts gehabt. So sind die Normen des Grundgesetzes, die von der Staatsangehörigkeit handeln, fast ausnahmslos als Reaktion auf die NS-Zeit zu verstehen. Daher sollen auch die nationalsozialistischen Maßnahmen auf dem Gebiet des Staatsangehörigkeitsrechts an dieser Stelle kurz skizziert werden, ohne daß dabei der Anpruch auf Vollständigkeit erhoben würde.
Systematische Konsequenzen für das Staatsangehörigkeitsrecht zeitigte der Übergang der
Nationalsozialisten zum Einheitsstaat. In § 1 Abs. 1 verfügte die Verordnung vom 5. Februar 1934 die Aufhebung der Staatsangehörigkeit in den Ländern. Folgerichtig bestimmte die Vorschrift des § 1 Abs. 2: „Es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit (Reichsangehörigkeit)“.
Seitdem hat das Vermittlungsprinzip ausgedient.
Trotz der Wiederherstellung der föderalistischen Ordnung ist es auch unter dem Grundgesetz nicht mehr reaktiviert worden.
Nicht minder bedeutsam ist das „Reichsbürgergesetz“ vom 15. September 1935.
Als Sonderkategorie innerhalb der Staatsangehörigkeit führte dieses Gesetz die „Reichsbürgerschaft“ ein, die allein gemäß § 2 Abs. 3 in Zukunft die vollen politischen Rechte vermitteln sollte, und beraubte die Staatsangehörigkeit so einer ihrer wichtigsten Funktionen: der – im positiven Sinne zu verstehenden – Nivellierungsfunktion. Nichtarier konnten nicht Reichsbürger sein (§ 2 Abs. 1 Reichsbürgergesetz).
Das Interim zwischen 1945 und 1949
Auf den Zweiten Weltkrieg folgte eine Übergangsphase, in der das Deutsche Reich mangels staatlicher Organe handlungsunfähig war. Nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 und der Verhaftung der Regierung Dönitz in Flensburg am 23. Mai 1945 übernahmen die vier Siegermächte die Regierungsgewalt.
Für „Deutschland als Ganzes betreffende Maßnahmen“ war fortan der Alliierte Kontrollrat zuständig.
Auf dem Gebiet des Staatsangehörigkeitsrechts zählten dazu alle legislatorischen Maßnahmen, während Einzelakte von den deutschen Behörden mit Zustimmung der jeweiligen Besatzungskommandanten bzw. der Berliner Kommandantur erlassen wurden.
Die deutsche Staatsangehörigkeit als Rechtsinstitut berührten diese Ereignisse freilich nicht.
Lediglich die nationalsozialistische Gesetzgebung wurde in Teilen korrigiert.
So hob der Alliierte Kontrollrat unter anderem das Reichsgesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14. Juli 1933 sowie das Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 und sämtliche auf seiner Grundlage ergangenen Verordnungen durch das Gesetz Nr. 1 vom 20. September 1945 auf.
Nach dem Auszug der sowjetischen Vertreter am 20. März 1948 stellte das Gremium seine Tätigkeit aber auch schon wieder ein. Durch das Gesetz Nr. 12 vom 17. November 1949 erklärte die Alliierte Hohe Kommission dann noch die zwangsweise Übertragung der deutschen Staatsangehörigkeit auf französische und luxemburgische Staatsangehörige durch das nationalsozialistische Regime für von Anfang an nicht.
Auch die Bildung der Länder nach dem Zweiten Weltkrieg hat auf das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht keine Auswirkungen gehabt.
Die Entwicklung unter dem Grundgesetz
Das Grundgesetz knüpft an verschiedenen Stellen an die Staatsangehörigkeit an,
regelt sie aber selbst kaum.
Vielmehr setzt es eine Regelung im einfachen Recht voraus.
Hier galt auch unter dem Grundgesetz lange Zeit das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz fort.
Das höherrangige Recht hat eine Reihe von Änderungen des aus dem Jahre 1913 stammen- den Gesetzes erforderlich gemacht. Im großen und ganzen haben die Schöpfer des Grundgesetzes jedoch in bemerkenswerter Manier die Kontinuität des Staatsangehörigkeitsrechts gewahrt.
Bevor die Bedeutung der Änderungen für die überkommenen Prinzipien des Staatsangehörigkeitsrechts untersucht wird, soll daher erst einmal ein Blick auf die Hintergründe dieser Kontinuität geworfen werden.
Die Einheit der deutschen Staatsangehörigkeit
Im ursprünglichen Konzept des Grundgesetzes spielte die Staatsangehörigkeit eine wesentliche Rolle, die mit der „Offenhaltung eines personalen Bandes“ zwischen dem Ost- und dem Westteil Deutschlands treffend umschrieben worden ist.
Nach der Rechtsprechung des BVerfG ging das Grundgesetz selbst – und „nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre!“ – davon aus, daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hatte und weder mit der Kapitulation noch auf Grund der Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen war.
Dies ergab sich aus der Präambel sowie aus Art. 23, 116 und 146 GG, sprich aus all jenen Passagen, die von den „Deutschen“, dem „deutschen Volk“ oder den „deutschen Staatsangehörigen“ handelten, und nicht etwa von einem Volk oder von Staatsangehörigen der Bundesrepublik Deutschland.
Die Grundentscheidung des Parlamentarischen Rates bestand demnach darin, mit der Bundesrepublik Deutschland keinen neuen westdeutschen Staat zu gründen, sondern lediglich einen Teilbereich des fortbestehenden gesamtdeutschen Staates zu reorganisieren.
Die Bundesrepublik Deutschland war auch nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches.
Sie war mit dem Deutschen Reich identisch, wobei sich ihre Hoheitsgewalt staatsrechtlich allerdings auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes beschränkte, so daß in bezug auf die räumliche Ausdehnung zunächst nur von einer „Teilidentität“ die Rede sein konnte. In dem anderen Teil Deutschlands wurde die Deutsche Demokratische Republik errichtet.
Gleichzeitig fühlte die Bundesrepublik sich aber für das ganze Deutschland verantwortlich, im Sinne eines „Repräsentanten“, der die Interessen des Gesamtstaates wahrnimmt, solange dieser selbst nicht dazu in der Lage ist.
Die Deutsche Demokratische Republik wurde daher nie als Ausland angesehen.
Die Ausdrücke „Staatsangehörigkeit im Bunde“ (Art. 73 Nr. 2 GG) und „Staatsangehörigkeit in den Ländern“ (Art. 74 Nr. 8 GG) dienten allein zur Abgrenzung der Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern; dazu schon oben, N 342. – Besonders deutlich illustriert die Entstehungsgeschichte des Art. 16 Abs. 1 GG (dazu im einzelnen unten, Dritter Teil D. II. 3.b)) den
Bedeutungszusammenhang: Nachdem in den Beratungen zu dieser Vorschrift
zunächst eine Fassung kursierte, in der von einer „Staatsangehörigkeit des Bundes“ die Rede war, ersetzte der Grundsatzausschuß des Parlamentarischen Rates die Bezeichnung auf Vorschlag des Abgeordneten Bergsträßer später durch „ die deutsche Staatsangehörigkeit“.
Bergsträßer begründete die Änderung wie folgt: „Da wir die Verfassung für Deutschland machen – nach einem Satz unserer Präambel – wollen wir sagen: „die deutsche Staatsangehörigkeit“. Wir machen doch eine Verfassung, zu der wir die anderen Deutschen einladen.; JöR N. F. Bd. 1 (1951), S. 16
374 Bernhardt, in: HStR I, ß 8, Rn. 32 ff. weist in diesem Zusammenhang auf einen seiner Ansicht nach unauflösbaren Widerspruch in der Rechtsprechung des BVerfG hin:
Einerseits soll das Deutsche Reich (nur) aus dem Grund handlungsunfähig gewesen sein, daß es keine eigenen Organe hatte.
Andererseits soll die Bundesrepublik Deutschland mit ihm identisch gewesen sein.
Die Bundesrepublik verfügte aber zweifellos über Organe, die demnach eigentlich auch Organe des Deutschen Reiches hätten sein müssen.
Der Schlüssel zum Verständnis dürfte in der vom BVerfG verwendeten Figur der Teilidentität liegen. Denkbar ist schließlich, daß ein Teil des Deutschen Reiches (als Bundesrepublik Deutschland) handlungsfähig geworden ist und diese Handlungsfähigkeit im Sinne des übergreifenden Ganzen eingesetzt hat, ohne daß dadurch das Deutsche Reich „als Gesamtstaat“ Handlungsfähigkeit erlangt hätte.
Dem stand die – wie auch immer zu bewertende – Existenz der Deutschen Demokratischen Republik entgegen, die nicht gewillt war, als „Organ“ Gesamtdeutschlands zu fungieren.
Das Szenario erinnert an mögliche Konflikte in einem föderalistisch organisierten Staat: Die Handlungsfähigkeit eines Bundeslandes macht noch keine Handlungsfähigkeit des Bundesstaates aus, wenn die anderen Bundesländer nicht „mitmachen“ und dem Bundesstaat die Mittel fehlen, diese zu disziplinieren. Allerdings leugnet Bernhardt, daß eine „Teilidentität“ überhaupt Sinn macht.
Der Bundesrepublik waren insoweit die Hände gebunden. Wenn das Grundgesetz vom Fortbestand des (gesamt-)deutschen Staates und damit des (gesamt-)deutschen Staatsvolkes ausging, so verfolgte es damit das Ziel, eines Tages eine Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands durchzuführen. Das Wiedervereinigungsgebot war in der Präambel verankert.
Aus dem Wiedervereinigungsgebot leitete das BVerfG auch das Gebot ab, alles zu unterlassen, was die Wiedervereinigung hätte vereiteln können (sogenanntes Wahrungsgebot).
Danach war es der Bundesrepublik Deutschland strengstens untersagt, auf „einen Rechtstitel (eine Rechtsposition) aus dem Grundgesetz“ zu verzichten, mittels dessen (derer) sie auf die Verwirklichung der Wiedervereinigung und der Selbstbestimmung des deutschen Volkes hätte hinwirken können.
In diesem Zusammenhang erlangte die Staatsangehörigkeit besondere Bedeutung.
Deswegen war es so wichtig, den Fortbestand des einen deutschen Volkes durch die Staatsangehörigkeit zu dokumentieren und in den Köpfen der Menschen wach zu halten.
Wie gut der Bundesrepublik dies gelungen war, zeigte sich im Herbst 1989, als in Dresden, Berlin und Leipzig hunderttausendfach der Ruf erklang: „Wir sind das Volk“, und bald darauf: „Wir sind ein Volk“.
Das BVerfG verstand die Staatsangehörigkeit als rechtlichen Hebel zur Förderung der Wiedervereinigung und Selbstbestimmung des deutschen Volkes.
Das Wahrungsgebot verlangte danach, die Staatsangehörigkeit auch rechtlich zu verwirklichen.
Daß die Hoheitsgewalt der Bundesrepublik Deutschland räumlich beschränkt war, hinderte sie zwar daran, einen Bürger der Deutschen Demokratischen Republik in Obhut zu nehmen, solange er sich im Ostteil Deutschlands auf hielt.
Sobald er aber irgendwie in den Schutzbereich der Bundesrepublik gelangte, hatte er gemäß Art. 116 Abs. 1 und Art. 16 GG einen Anspruch darauf, wie jeder Bürger der Bundesrepublik als Deutscher behandelt zu werden, d. h. er genoß den vollen Schutz der Gerichte und alle Garantien der Grundrechte des Grundgesetzes (vor allem auch der Deutschenrechte).
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes waren eben nicht nur die Bürger der Bundesrepublik Deutschland.
Auf Grund der Rechtsprechung des BVerfG stellte sich alsbald auch die Frage, wie mit den Fällen umzugehen sei, in denen formal nur noch die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik erworben wurde.
Das BVerwG sah keinen Anlaß dazu, diesen Erwerb als Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit anzuerkennen, wenn er nicht im Einklang mit den Erwerbsregeln des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes stand.
Daher maß das Gericht dem Erwerb der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik für die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland
in den Grenzen des „ordre public“ die Rechtswirkung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit bei.
Auf eine Entsprechung der Erwerbsregel im Recht der Bundesrepublik kam es ihm dabei grundsätzlich nicht an.
Staatsangehörigkeitsrechtliche Verlustgründe der Deutschen Demokratischen Republik führten hingegen nicht zum Verlust Demokratischen Republik führten hingegen nicht zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, da das Wahrungsgebot dies nicht erforderte.
Der Status des Deutschen ohne Staatsangehörigkeit, Art. 116 Abs. 1 GG
In Art. 116 Abs. 1 GG wird der Begriff des Deutschen definiert:
„Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat“.
Die Besonderheit dieser Definition besteht darin, daß sie nicht allein auf die Staatsangehörigkeit rekurriert. Andernfalls hätte man auf eine ausdrückliche Regelung wohl ganz verzichtet.
Als weiteren Anknüpfungspunkt für die Deutscheneigenschaft nennt die Vorschrift des Art. 116 Abs. 1 GG die deutsche Volkszugehörigkeit der Flüchtlinge und Vertriebenen, soweit sie im Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937, d. h. vor den Annexionen unter Hitler Aufnahme gefunden haben.
Damit wird ein Status begründet, der unabhängig von der deutschen Staatsangehörigkeit ist.
Die betroffenen Personen werden gemeinhin als „Statusdeutsche“ bezeichnet.
Sie sind den deutschen Staatsangehörigen weitgehend gleichgestellt.
Warum aber ist die Spezialregelung des Art. 116 Abs. 1 GG dann überhaupt in das Grundgesetzeingefügt worden?
Hintergrund war die besondere Nachkriegssituation. Flüchtlinge und Vertriebene, die in großer Zahl nach Deutschland kamen, besaßen vielfach nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die Wiedergutmachung der Zwangsausbürgerungen, Art. 116 Abs. 2 GG
Art. 116 Abs. 2 GG beinhaltet eine Regelung für die Personen, denen die deutsche Staatsangehörigkeit in der NS-Zeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen wurde.
Dies betrifft vor allem das Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14. Juli 1933 sowie die 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941.
Der Schutz des Bestandes der deutschen Staatsangehörigkeit, Art. 16 Abs. 1
Systematik und Regelungsgehalt.
Da die Entstehungsgeschichte des Art. 16 Abs. 1 GG sich relativ kompliziert ausnimmt, soll an dieser Stelle noch ein kurzer Überblick über Systematik und Regelungsgehalt der Endfassung gegeben werden.
Die Vorschrift enthält zwei Verbürgungen der deutschen Staatsangehörigkeit: einen absoluten Schutz vor der Entziehung (erster Satz) und einen eingeschränkten Schutz vor dem Verlust (zweiter Satz).
Hinsichtlich des Verlustes kann weiter danach differenziert werden, ob der Betroffene dadurch staatenlos würde oder nicht. Ist dies der Fall, so steht der Verlust gemäß Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG unter dem Vorbehalt, daß der Betroffene damit einverstanden ist.
Unabhängig davon muß der Verlust „auf Grund eines Gesetzes“ eintreten.
Diese Formulierung des Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG stellt nach allgemeiner Ansicht ein Redaktionsversehen dar. Insoweit besteht Einigkeit, darf der Verlust nicht unbedingt einen Akt der Exekutive voraussetzt, sondern auch unmittelbar an die Verwirklichung eines gesetzlichen Tatbestandes anschließen kann.
Art. 16 Abs. 1 GG hat Grundrechtscharakter mit allen daraus folgenden Konsequenzen: Die Vorschrift statuiert ein subjektives Abwehrrecht im Sinne des status negativus und hat zugleich – wie jedes andere Grundrecht auch – teil an der objektiven Wertordnung des Grundgesetzes.
Auswirkungen des Grundgesetzes auf die Überkommenen Prinzipien des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts
Das Ius-sanguinis-Prinzip
Das Grundgesetz tastete das hergebrachte Prinzip des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit durch Geburt nicht an.
Im Gegenteil: In Art. 116 Abs. 1 und 2 GG bestätigte es die Geltung des Ius-sanguinis-Prinzips im einfachen Recht.
Offenbar richtet es sich in diesen Sonderregelungen an dem vorgefundenen Rechtszustand aus.
So erstreckt sich der Status des Deutschen ohne Staatsangehörigkeit nach dem ersten Absatz des Art. 116 GG auf die Abkömmlinge der Flüchtlinge oder Vertriebenen deutscher Volkszugehörigkeit, die in dem Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden haben.
Nach dem zweiten Absatz der Bestimmung erfaßt der Wiedereinbürgerungsanspruch auch die Abkömmlinge der zwangsausgebürgerten Deutschen. Beide Rechtspositionen werden also ebenso in der Familie „weitervererbt“ wie die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts von 1999
Freilich kam die Reform nicht von heute auf morgen. Reformbestrebungen gab es schon seit geraumer Zeit, nur waren sie bis dahin allesamt gescheitert. Die Gründe dafür haben die Gestalt, welche das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht schließlich im Jahre 1999 erhalten hat, nachhaltig beeinflußt. Daher lohnt es sich, zunächst diejenigen Reformansätze zu betrachten, die nicht verwirklicht worden sind.
Die Reformbestrebungen von 1989 bis 1998
Reformbestrebungen grundlegender Art setzten danach erst wieder ein, als die Wiedervereinigung bereits in greifbare Nähe gerückt war. Von 1989 bis 1998 standen sich im wesentlichen zwei Positionen gegenüber, deren Gegensätzlichkeit das Zustandekommen einer Reform verhinderte: der Standpunkt der Opposition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf der einen sowie der Standpunkt der Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP auf der anderen Seite.
Der Standpunkt der Opposition
aa) Erleichterung der Einbürgerung
Die mit der Änderung des Ausländergesetzes zu Beginn der 90er Jahre verbundene Erleichterung der Einbürgerung ging nicht so weit, wie die Opposition es gerne gesehen hätte.
bb) Einführung des ius soli
Neben einer Erleichterung der Einbürgerung strebte die Opposition auch eine Einführung des Ius-soli-Prinzips in das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht an. Das Ius-sanguinis-Prinzip, das den Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Geburt bis dato ausschließlich geregelt hatte, sollte dadurch zwar nicht verdrängt, aber wenigstens ergänzt werden. Zwei unterschiedliche Varianten des ius soli kristallisierten sich dabei heraus.
Das Zustandekommen der Reform im Jahre 1999
Mit der Übernahme der Regierungsgeschäfte zur 14. Legislaturperiode bot sich den vormaligen Oppositionsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen plötzlich die Gelegenheit, ihre lange Zeit vergeblich gehegten Reformvorhaben endlich zu realisieren. Diese Gelegenheit ergriffen sie sogleich beim Schopfe. Weder bei der anvisierten Erleichterung der Anspruchseinbürgerung nach §§ 85 ff. AuslG noch bei der Einführung des Ius-soli-Prinzips nahm ein von Bundesinnenminister Otto Schily am 13. Januar 1999 geradezu blitzartig vorgelegter Arbeitsentwurf Rücksicht auf den Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatlichkeit. Nach dem Stillstand der letzten Jahre sollte der Entwurf vor allem Handlungsfähigkeit demonstrieren. Aussicht auf Erfolg hatte er freilich nicht. Zu groß war der Widerstand in der Bevölkerung. Mit Blick auf den hessischen Landtagswahlkampf initiierte die CDU eine Unterschriftenkampagne gegen die Hinnahme von Mehrstaatlichkeit. Die
Resonanz auf diese Kampagne wurde allgemein als (mit-)entscheidend für den anschließenden Wahlsieg der Partei angesehen.
B. Ziel der Reform
Für die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahre 1999 gab es im wesentlichen zwei Gründe:
Vermeintlichen Reformdruck erzeugte zunächst das hohe Alter des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes. Schon allein die Tatsache, daß dessen Gestalt sich seit 1913 kaum verändert hatte, genügte in den Augen vieler, um eine „Modernisierung“ des Rechtsgebiets zu rechtfertigen.
Auch im europiischen Vergleich galt das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz
als anachronistisch.
Stein des Anstoßes war insbesondere das Ius-sanguinis-Prinzip.
Vom deutschen „Blutrecht“, das noch immer einem Nationalismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts huldige, obwohl die Geschichte doch längst eines Besseren belehrt habe, war da – nicht ohne ein gerüttelt Maß Polemik – die Rede.
Als Relikt vergangener Tage gehöre das an der Abstammung orientierte Denken endgültig über Bord geworfen.
Das Bemühen des Reformgesetzgebers, alte Zöpfe des Staatsangehörigkeitsrechts abzuschneiden, ist schon an der Überschrift abzulesen:
Statt „Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz“ heißt es dort nunmehr schlicht
„Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)“. Allerdings ist das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz durch die Reform nicht abgeschafft, sondern lediglich abgeändert worden.
Insbesondere die Erwartung, alle die Staatsangehörigkeit betreffenden Vorschriften werden endlich in einem Gesetz konzentriert werden, hat der Gesetzgeber enttäuscht: Auch nach der Reform bleibt es bei der teilweisen Verlagerung der Einbürgerungsvorschriften in das Ausländergesetz.
Die Änderungen betreffen vor allem die Regelungen des Erwerbs der Staatsangehörigkeit durch Geburt und des Verlusts der Staatsangehörigkeit. Eine völlig neue Gestalt hat zudem der Einbürgerungsanspruch in den §§ 85 ff. AuslG 1999 erhalten. Im Übrigen diente das Staatsangehörigkeitsreformgesetz dazu, alte Regelungen an die neue Rechtslage anzupassen.
Während einige Folgeänderungen anderer Gesetze nichtig waren, hat die Reform die Staatsangehörigkeitsverordnungen vom 5. Februar 1934 und vom 20. Januar 1942 gänzlich hinfällig gemacht und folglich außer Kraft gesetzt.