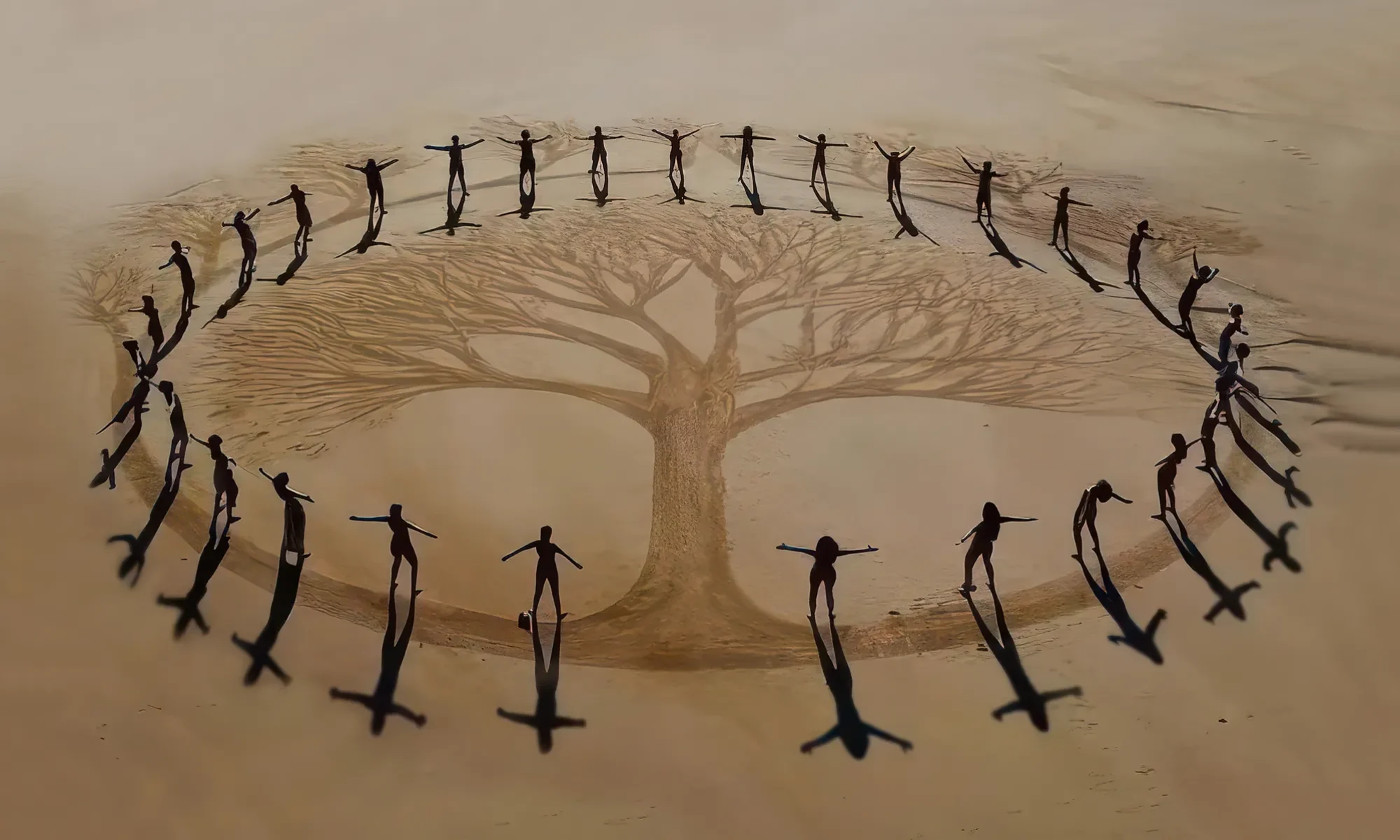(das Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft Trier ohne Angaben von Gründen eingestellt, ohne jegliche Nachfrage bzw. Befragung meiner Person.)
………, den 25. Sept. 2021
per Fax
Betreff: Strafanzeige wegen berechtigtem Verdacht des Wahlbetruges zur Bundestagswahl, den 26.09.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hiermit stelle der Unterzeichner im Zusammenhang mit dem berechtigten Verdacht von massivem Wahlbetrug zur Bundestagswahl am 26.09.2021 entsprechend den §§:
§ 107a Wahlfälschung
(1) Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt.
(2) Ebenso wird bestraft, wer das Ergebnis einer Wahl unrichtig verkündet oder verkünden läßt.
(3) Der Versuch ist strafbar.
§ 107b Fälschung von Wahlunterlagen
(1) Wer
1. seine Eintragung in die Wählerliste (Wahlkartei) durch falsche Angaben erwirkt,
2. einen anderen als Wähler einträgt, von dem er weiß, daß er keinen Anspruch auf Eintragung hat,
3. die Eintragung eines Wahlberechtigten als Wähler verhindert, obwohl er dessen Wahlberechtigung kennt,
4. sich als Bewerber für eine Wahl aufstellen läßt, obwohl er nicht wählbar ist,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
(2) Der Eintragung in die Wählerliste als Wähler entspricht die Ausstellung der Wahlunterlagen für die Urwahlen in der Sozialversicherung.
§ 108 Wählernötigung
(1) Wer rechtswidrig mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel, durch Mißbrauch eines beruflichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisses oder durch sonstigen wirtschaftlichen Druck einen anderen nötigt oder hindert, zu wählen oder sein Wahlrecht in einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
§ 1 Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und Wahlrechtsgrundsätze
(1) Der Deutsche Bundestag besteht vorbehaltlich der sich aus diesem Gesetz ergebenden Abweichungen aus 598 Abgeordneten. Sie werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den wahlberechtigten Deutschen nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt.
(2) Von den Abgeordneten werden 299 nach Kreiswahlvorschlägen in den Wahlkreisen und die übrigen nach Landeswahlvorschlägen (Landeslisten) gewählt.
- 9 Abs. 2 Satz 1 u. 2, Abs. 4 Satz 1 u. 2 BWahlG
§ 9 Bildung der Wahlorgane
(1) Der Bundeswahlleiter und sein Stellvertreter werden vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, die Landeswahlleiter, Kreiswahlleiter und Wahlvorsteher sowie ihre Stellvertreter von der Landesregierung oder der von ihr bestimmten Stelle ernannt.
(2) Der Bundeswahlausschuß besteht aus dem Bundeswahlleiter als Vorsitzendem sowie acht von ihm berufenen Wahlberechtigten als Beisitzern und zwei Richtern des Bundesverwaltungsgerichts. Die übrigen Wahlausschüsse bestehen aus dem Wahlleiter als Vorsitzendem und sechs von ihm berufenen Wahlberechtigten als Beisitzern; in die Landeswahlausschüsse sind zudem zwei Richter des Oberverwaltungsgerichts des Landes zu berufen. Die Wahlvorstände bestehen aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzendem, seinem Stellvertreter und weiteren drei bis sieben vom Wahlvorsteher berufenen Wahlberechtigten als Beisitzern; die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann anordnen, daß die Beisitzer des Wahlvorstandes von der Gemeindebehörde und die Beisitzer des Wahlvorstandes zur Feststellung des Briefwahlergebnisses vom Kreiswahlleiter, im Falle einer Anordnung nach § 8 Abs. 3 von der Gemeindebehörde oder von der Kreisverwaltungsbehörde allein oder im Einvernehmen mit dem Wahlvorsteher berufen werden. Bei Berufung der Beisitzer sind die in dem jeweiligen Bezirk vertretenen Parteien nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
(3) Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerber, Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge und stellvertretende Vertrauenspersonen dürfen nicht zu Mitgliedern eines Wahlorgans bestellt werden.
(4) Die Gemeindebehörden sind befugt, personenbezogene Daten von Wahlberechtigten zum Zweck ihrer Berufung zu Mitgliedern von Wahlvorständen zu erheben und zu verarbeiten. Zu diesem Zweck dürfen personenbezogene Daten von Wahlberechtigten, die zur Tätigkeit in Wahlvorständen geeignet sind, auch für künftige Wahlen verarbeitet werden, sofern der Betroffene der Verarbeitung nicht widersprochen hat. Der Betroffene ist über das Widerspruchsrecht zu unterrichten. Im Einzelnen dürfen folgende Daten erhoben und verarbeitet werden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummern, Zahl der Berufungen zu einem Mitglied der Wahlvorstände und die dabei ausgeübte Funktion.
(5) Auf Ersuchen der Gemeindebehörden sind zur Sicherstellung der Wahldurchführung die Behörden des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts verpflichtet, aus dem Kreis ihrer Bediensteten unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift zum Zweck der Berufung als Mitglieder der Wahlvorstände Personen zu benennen, die im Gebiet der ersuchenden Gemeinde wohnen. Die ersuchte Stelle hat den Betroffenen über die übermittelten Daten und den Empfänger zu benachrichtigen.
§ 11 Ehrenämter
(1) Die Beisitzer der Wahlausschüsse und die Mitglieder der Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur Übernahme dieses Ehrenamtes ist jeder Wahlberechtigte verpflichtet. Das Ehrenamt darf nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden.
(2) (weggefallen)
(3) (weggefallen)
- 12 Abs.1, 2, 2 Satz 2 BWahlG
§ 12 Wahlrecht
(1) Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltage
- das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben,
2. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten,
3. nicht nach § 13 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
(2) Wahlberechtigt sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch diejenigen Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die am Wahltag außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sofern sie
1. nach Vollendung ihres vierzehnten Lebensjahres mindestens drei Monate ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt oder
2. aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen betroffen sind.
Als Wohnung oder gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne von Satz 1 gilt auch eine frühere Wohnung oder ein früherer Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet. Bei Rückkehr eines nach Satz 1 Wahlberechtigten in die Bundesrepublik Deutschland gilt die Dreimonatsfrist des Absatzes 1 Nr. 2 nicht.
(3) Wohnung im Sinne des Gesetzes ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird. Wohnwagen und Wohnschiffe sind jedoch nur dann als Wohnungen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden.
(4) Sofern sie in der Bundesrepublik Deutschland keine Wohnung innehaben oder innegehabt haben, gilt als Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 oder des Absatzes 2 Satz 1
1. für Seeleute sowie für die Angehörigen ihres Hausstandes das von ihnen bezogene Schiff, wenn dieses nach dem Flaggenrechtsgesetz in der jeweils geltenden Fassung die Bundesflagge zu führen berechtigt ist,
2. für Binnenschiffer sowie für die Angehörigen ihres Hausstandes das von ihnen bezogene Schiff, wenn dieses in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist,
3. für im Vollzug gerichtlich angeordneter Freiheitsentziehung befindliche Personen sowie für andere Untergebrachte die Anstalt oder die entsprechende Einrichtung.
(5) Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Satz 1 ist der Tag der Wohnungs- oder Aufenthaltsnahme in die Frist einzubeziehen.
§ 14 Ausübung des Wahlrechts
(1) Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.
(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.
(3) Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl des Wahlkreises, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
(4) Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig.
(5) Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.
- 15 Abs. 1 Nummer 1 BWahlG
§ 15 Wählbarkeit
(1) Wählbar ist, wer am Wahltage
1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist und
2. das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.
(2) Nicht wählbar ist,
1.
wer nach § 13 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder
2. wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.
3. (weggefallen)
- 17 Abs. 1 Satz 1 u. 2, Abs.2 BWahlG
§ 17 Wählerverzeichnis und Wahlschein
(1) Die Gemeindebehörden führen für jeden Wahlbezirk ein Verzeichnis der Wahlberechtigten. Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, an den Werktagen vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl während der allgemeinen Öffnungszeiten die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte während des in Satz 2 genannten Zeitraumes nur dann ein Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung gemäß Satz 3 besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
(2) Ein Wahlberechtigter, der im Wählerverzeichnis eingetragen ist, oder der aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund in das Wählerverzeichnis nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.
§ 18 Wahlvorschlagsrecht, Beteiligungsanzeige
(1) Wahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 von Wahlberechtigten eingereicht werden.
(2) Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am siebenundneunzigsten Tage vor der Wahl bis 18 Uhr dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuß ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige muß von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden.
(3) Der Bundeswahlleiter hat die Anzeige nach Absatz 2 unverzüglich nach Eingang zu prüfen. Stellt er Mängel fest, so benachrichtigt er sofort den Vorstand und fordert ihn auf, behebbare Mängel zu beseitigen. Nach Ablauf der Anzeigefrist können nur noch Mängel an sich gültiger Anzeigen behoben werden. Eine gültige Anzeige liegt nicht vor, wenn
- die Form oder Frist des Absatzes 2 nicht gewahrt ist,
2. die Parteibezeichnung fehlt,
3. die nach Absatz 2 erforderlichen gültigen Unterschriften und die der Anzeige beizufügenden Anlagen fehlen, es sei denn, diese Anlagen können infolge von Umständen, die die Partei nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig vorgelegt werden,
4. die Vorstandsmitglieder mangelhaft bezeichnet sind, so daß ihre Person nicht feststeht.
Nach der Entscheidung über die Feststellung der Parteieigenschaft ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen. Gegen Verfügungen des Bundeswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann der Vorstand den Bundeswahlausschuß anrufen.
(4) Der Bundeswahlausschuß stellt spätestens am neunundsiebzigsten Tage vor der Wahl für alle Wahlorgane verbindlich fest,
1. welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren,
2. welche Vereinigungen, die nach Absatz 2 ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind; für die Ablehnung der Anerkennung als Partei für die Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.
Die Feststellung ist vom Bundeswahlleiter in der Sitzung des Bundeswahlausschusses bekannt zu geben. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.
(4a) Gegen eine Feststellung nach Absatz 4, die sie an der Einreichung von Wahlvorschlägen hindert, kann eine Partei oder Vereinigung binnen vier Tagen nach Bekanntgabe Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. In diesem Fall ist die Partei oder Vereinigung von den Wahlorganen bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, längstens bis zum Ablauf des neunundfünfzigsten Tages vor der Wahl wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln.
(5) Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag und in jedem Land nur eine Landesliste einreichen.
§ 20 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge
(1) Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.
(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von dem Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Kreiswahlvorschläge der in § 18 Abs. 2 genannten Parteien müssen außerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung muß im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minderheiten.
(3) Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.
(4) Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, andere Kreiswahlvorschläge ein Kennwort enthalten.
§ 21 Aufstellung von Parteibewerbern
(1) Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist. Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers ist eine Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der Partei. Besondere Vertreterversammlung ist eine Versammlung der von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte gewählten Vertreter. Allgemeine Vertreterversammlung ist eine nach der Satzung der Partei (§ 6 des Parteiengesetzes) allgemein für bevorstehende Wahlen von einer derartigen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte bestellte Versammlung.
(2) In Kreisen und kreisfreien Städten, die mehrere Wahlkreise umfassen, können die Bewerber für diejenigen Wahlkreise, deren Gebiet die Grenze des Kreises oder der kreisfreien Stadt nicht durchschneidet, in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Vertreterversammlung gewählt werden.
(3) Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen werden in geheimer Abstimmung gewählt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlen dürfen frühestens 32 Monate, für die Vertreterversammlungen frühestens 29 Monate nach Beginn der Wahlperiode des Deutschen Bundestages stattfinden; dies gilt nicht, wenn die Wahlperiode vorzeitig endet.
(4) Der Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, die Vorstände der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, oder eine andere in der Parteisatzung hierfür vorgesehene Stelle können gegen den Beschluß einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig.
(5) Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlußfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien durch ihre Satzungen.
(6) Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Kreiswahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teilnehmer gegenüber dem Kreiswahlleiter an Eides Statt zu versichern, dass die Anforderungen gemäß Absatz 3 Satz 1 bis 3 beachtet worden sind. Der Kreiswahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides Statt zuständig; er gilt als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
§ 24 Änderung von Kreiswahlvorschlägen
Ein Kreiswahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungsfrist nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das Verfahren nach § 21 braucht nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften nach § 20 Abs. 2 und 3 bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1) ist jede Änderung ausgeschlossen.
§ 25 Beseitigung von Mängeln
(1) Der Kreiswahlleiter hat die Kreiswahlvorschläge unverzüglich nach Eingang zu prüfen. Stellt er bei einem Kreiswahlvorschlag Mängel fest, so benachrichtigt er sofort die Vertrauensperson und fordert sie auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen.
(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn
- die Form oder Frist des § 19 nicht gewahrt ist,
2. die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 3 erforderlichen gültigen Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,
3. bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 18 Abs. 2 erforderliche Feststellung der Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die Nachweise des § 21 nicht erbracht sind,
4. der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so daß seine Person nicht feststeht, oder
5. die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt.
(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen.
(4) Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann die Vertrauensperson den Kreiswahlausschuß anrufen.
§ 23 Zurücknahme von Kreiswahlvorschlägen
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen werden.
§ 25 Beseitigung von Mängeln
(1) Der Kreiswahlleiter hat die Kreiswahlvorschläge unverzüglich nach Eingang zu prüfen. Stellt er bei einem Kreiswahlvorschlag Mängel fest, so benachrichtigt er sofort die Vertrauensperson und fordert sie auf, behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen.
(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn
- die Form oder Frist des § 19 nicht gewahrt ist,
2. die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 3 erforderlichen gültigen Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,
3. bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 18 Abs. 2 erforderliche Feststellung der Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die Nachweise des § 21 nicht erbracht sind,
4. der Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so daß seine Person nicht feststeht, oder
5. die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt.
(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlages (§ 26 Abs. 1 Satz 1) ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen.
(4) Gegen Verfügungen des Kreiswahlleiters im Mängelbeseitigungsverfahren kann die Vertrauensperson den Kreiswahlausschuß anrufen.
§ 26 Zulassung der Kreiswahlvorschläge
(1) Der Kreiswahlausschuß entscheidet am achtundfünfzigsten Tage vor der Wahl über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge. Er hat Kreiswahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie
- verspätet eingereicht sind oder
2. den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz und die Bundeswahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, daß in diesen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.
Die Entscheidung ist in der Sitzung des Kreiswahlausschusses bekanntzugeben.
(2) Weist der Kreiswahlausschuß einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Landeswahlausschuß eingelegt werden. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson des Kreiswahlvorschlages, der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter. Der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch die ein Kreiswahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben. In der Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen Beteiligten zu hören. Die Entscheidung über die Beschwerde muß spätestens am zweiundfünfzigsten Tage vor der Wahl getroffen werden.
(3) Der Kreiswahlleiter macht die zugelassenen Kreiswahlvorschläge spätestens am achtundvierzigsten Tage vor der Wahl öffentlich bekannt.
§ 27 Landeslisten
(1) Landeslisten können nur von Parteien eingereicht werden. Sie müssen von dem Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, die im Bereich des Landes liegen, bei den in § 18 Abs. 2 genannten Parteien außerdem von 1 vom Tausend der Wahlberechtigten des Landes bei der letzten Bundestagswahl, jedoch höchstens 2.000 Wahlberechtigten, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner eines Wahlvorschlages einer der in § 18 Abs. 2 genannten Parteien muß im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung der Landesliste nachzuweisen. Das Erfordernis zusätzlicher Unterschriften gilt nicht für Landeslisten von Parteien nationaler Minderheiten.
(2) Landeslisten müssen den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese enthalten.
(3) Die Namen der Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein.
(4) Ein Bewerber kann nur in einem Land und hier nur in einer Landesliste vorgeschlagen werden. In einer Landesliste kann nur benannt werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erklärt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.
(5) § 21 Abs. 1, 3, 5 und 6 sowie die §§ 22 bis 25 gelten entsprechend mit der Maßgabe, daß die Versicherung an Eides Statt nach § 21 Abs. 6 Satz 2 sich auch darauf zu erstrecken hat, daß die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber in der Landesliste in geheimer Abstimmung erfolgt ist.
§ 28 Zulassung der Landeslisten
(1) Der Landeswahlausschuß entscheidet am achtundfünfzigsten Tage vor der Wahl über die Zulassung der Landeslisten. Er hat Landeslisten zurückzuweisen, wenn sie
- verspätet eingereicht sind oder
2. den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz und die Bundeswahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, daß in diesen Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.
Sind die Anforderungen nur hinsichtlich einzelner Bewerber nicht erfüllt, so werden ihre Namen aus der Landesliste gestrichen. Die Entscheidung ist in der Sitzung des Landeswahlausschusses bekanntzugeben.
(2) Weist der Landeswahlausschuß eine Landesliste ganz oder teilweise zurück, so kann binnen drei Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Bundeswahlausschuß eingelegt werden. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson der Landesliste und der Landeswahlleiter. Der Landeswahlleiter kann auch gegen eine Entscheidung, durch die eine Landesliste zugelassen wird, Beschwerde erheben. In der Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen Beteiligten zu hören. Die Entscheidung über die Beschwerde muß spätestens am zweiundfünfzigsten Tage vor der Wahl getroffen werden.
(3) Der Landeswahlleiter macht die zugelassenen Landeslisten spätestens am achtundvierzigsten Tage vor der Wahl öffentlich bekannt.
§ 40 Entscheidung des Wahlvorstandes
Der Wahlvorstand entscheidet über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen und über alle bei der Wahlhandlung und bei der Ermittlung des Wahlergebnisses sich ergebenden Anstände. Der Kreiswahlausschuß hat das Recht der Nachprüfung.
§ 46 Verlust der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag
(1) Ein Abgeordneter verliert die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag bei
- Ungültigkeit des Erwerbs der Mitgliedschaft,
2. Neufeststellung des Wahlergebnisses,
3. Wegfall einer Voraussetzung seiner jederzeitigen Wählbarkeit,
4. Verzicht,
5. Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei oder der Teilorganisation einer Partei, der er angehört, durch das Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes.
Verlustgründe nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.
(2) Bei Ungültigkeit seiner Wahl im Wahlkreis bleibt der Abgeordnete Mitglied des Bundestages, wenn er zugleich auf einer Landesliste gewählt war, aber nach § 6 Absatz 6 Satz 7 unberücksichtigt geblieben ist.
(3) Der Verzicht ist nur wirksam, wenn er zur Niederschrift des Präsidenten des Deutschen Bundestages, eines deutschen Notars, der seinen Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat, oder eines zur Vornahme von Beurkundungen ermächtigten Bediensteten einer deutschen Auslandsvertretung erklärt wird. Die notarielle oder bei einer Auslandsvertretung abgegebene Verzichtserklärung hat der Abgeordnete dem Bundestagspräsidenten zu übermitteln. Der Verzicht kann nicht widerrufen werden.
(4) Wird eine Partei oder die Teilorganisation einer Partei durch das Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärt, verlieren die Abgeordneten ihre Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag und die Listennachfolger ihre Anwartschaft, sofern sie dieser Partei oder Teilorganisation in der Zeit zwischen der Antragstellung (§ 43 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht) und der Verkündung der Entscheidung (§ 46 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht) angehört haben. Soweit Abgeordnete, die nach Satz 1 ihre Mitgliedschaft verloren haben, in Wahlkreisen gewählt waren, wird die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten in diesen Wahlkreisen bei entsprechender Anwendung des § 44 Abs. 2 bis 4 wiederholt; hierbei dürfen die Abgeordneten, die nach Satz 1 ihre Mitgliedschaft verloren haben, nicht als Bewerber auftreten. Soweit Abgeordnete, die nach Satz 1 ihre Mitgliedschaft verloren haben, nach einer Landesliste der für verfassungswidrig erklärten Partei oder Teilorganisation der Partei gewählt waren, bleiben die Sitze unbesetzt. Im übrigen gilt § 48 Abs. 1.
§ 52 Erlass von Rechtsverordnungen
(1) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderliche Bundeswahlordnung. Es trifft darin insbesondere Rechtsvorschriften über
die Bestellung der Wahlleiter und Wahlvorsteher, die Bildung der Wahlausschüsse und Wahlvorstände sowie über die Tätigkeit, Beschlussfähigkeit und das Verfahren der Wahlorgane,
2. die Berufung in ein Wahlehrenamt, über den Ersatz von Auslagen für Inhaber von Wahlehrenämtern und über das Bußgeldverfahren,
3.
die Wahlzeit,
4. die Bildung der Wahlbezirke und ihre Bekanntmachung,
5. die einzelnen Voraussetzungen für die Aufnahme in die Wählerverzeichnisse, deren Führung, Berichtigung und Abschluss, über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse, über den Einspruch und die Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis sowie über die Benachrichtigung der Wahlberechtigten,
6. die einzelnen Voraussetzungen für die Erteilung von Wahlscheinen, deren Ausstellung, über den Einspruch und die Beschwerde gegen die Ablehnung von Wahlscheinen,
7. den Nachweis der Wahlrechtsvoraussetzungen,
8. das Verfahren der Wahlorgane nach § 18 Absatz 2 bis 4a,
9. Einreichung, Inhalt und Form der Wahlvorschläge sowie der dazugehörigen Unterlagen, über ihre Prüfung, die Beseitigung von Mängeln, ihre Zulassung, die Beschwerde gegen Entscheidungen des Kreiswahlausschusses und des Landeswahlausschusses sowie die Bekanntgabe der Wahlvorschläge,
10. Form und Inhalt des Stimmzettels und über den Stimmzettelumschlag,
11. Bereitstellung, Einrichtung und Bekanntmachung der Wahlräume sowie über Wahlschutzvorrichtungen und Wahlkabinen,
12. die Stimmabgabe, auch soweit besondere Verhältnisse besondere Regelungen erfordern,
13. die Briefwahl,
14.
die Abgabe und Aufnahme von Versicherungen an Eides statt,
15. die Wahl in Kranken- und Pflegeanstalten, Klöstern, gesperrten Wohnstätten sowie sozialtherapeutischen und Justizvollzugsanstalten,
16. die Feststellung der Wahlergebnisse, ihre Weitermeldung und Bekanntgabe sowie die Benachrichtigung der Gewählten,
17. die Durchführung von Nachwahlen, Wiederholungswahlen und Ersatzwahlen sowie die Berufung von Listennachfolgern.
(2) Die Rechtsvorschriften bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates.
(3) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, im Falle einer Auflösung des Deutschen Bundestages die in dem Bundeswahlgesetz und in der Bundeswahlordnung bestimmten Fristen und Termine durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates abzukürzen.
(4) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, im Falle einer Naturkatastrophe oder eines ähnlichen Ereignisses höherer Gewalt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages von den Bestimmungen über die Aufstellung von Wahlbewerbern abweichende Regelungen zu treffen und Abweichungen der Parteien von entgegenstehenden Bestimmungen ihrer Satzungen zuzulassen, um die Benennung von Wahlbewerbern ohne Versammlungen, soweit erforderlich, zu ermöglichen, wenn der Deutsche Bundestag zu einem Zeitpunkt, der näher als neun Monate vor dem Beginn des nach Artikel 39 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes bestimmten Zeitraums liegt, feststellt, dass die Durchführung von Versammlungen ganz oder teilweise unmöglich ist. Stehen einem rechtzeitigen Zusammentritt des Deutschen Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegen oder ist er nicht beschlussfähig, so entscheidet der nach § 3 des Wahlprüfungsgesetzes gebildete Ausschuss des Deutschen Bundestages über die Feststellung und die Zustimmung nach Satz 1. Durch Rechtsverordnung nach Satz 1 können Regelungen getroffen werden, die den Parteien für die Wahl bei Vorliegen der in Satz 1 genannten Umstände eine Abweichung von den entgegenstehenden Bestimmungen dieses Gesetzes, der Bundeswahlordnung und, sofern eine Satzungsänderung wegen der in Satz 1 genannten Umstände und der in diesem Gesetz und der Bundeswahlordnung bestimmten Fristen und Termine nicht mehr rechtzeitig möglich ist, ihrer Satzungen ermöglichen, insbesondere,
- um die Wahl der Wahlbewerber und der Vertreter für die Vertreterversammlungen unter Verringerung der satzungsgemäßen Zahl der Vertreter in der Vertreterversammlung oder anstatt durch eine Mitgliederversammlung durch eine Vertreterversammlung durchführen zu können,
2. um Mitglieder- oder Vertreterversammlungen in der Form mehrerer miteinander im Wege der elektronischen Kommunikation verbundener gleichzeitiger Teilversammlungen an verschiedenen Orten durchführen zu können,
3. um die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts, des Vorstellungsrechts und der sonstigen Mitgliederrechte mit Ausnahme der Schlussabstimmung über einen Wahlvorschlag ausschließlich oder zusätzlich im Wege elektronischer Kommunikation ermöglichen zu können,
4. um die Wahl von Wahlbewerbern und Vertretern für die Vertreterversammlungen im Wege der Briefwahl oder einer Kombination aus Urnenwahl und Briefwahl durchführen zu können.
§ 4 Bildung der Wahlausschüsse
(1) Der Bundeswahlleiter, die Landeswahlleiter und die Kreiswahlleiter berufen alsbald nach der Bestimmung des Tages der Hauptwahl die Beisitzer der Wahlausschüsse und für jeden Beisitzer einen Stellvertreter. Die Beisitzer der Landeswahlausschüsse und der Kreiswahlausschüsse sind aus den Wahlberechtigten des jeweiligen Gebietes zu berufen; sie sollen möglichst am Sitz des Wahlleiters wohnen.
(2) Bei der Auswahl der Beisitzer der Wahlausschüsse sollen in der Regel die Parteien in der Reihenfolge der bei der letzten Bundestagswahl in dem jeweiligen Gebiet errungenen Zahlen der Zweitstimmen angemessen berücksichtigt und die von ihnen rechtzeitig vorgeschlagenen Wahlberechtigten berufen werden.
(3) Der Bundeswahlleiter beruft zwei Richter des Bundesverwaltungsgerichts, die Landeswahlleiter berufen je zwei Richter des Oberverwaltungsgerichts des Landes und jeweils einen Stellvertreter. Die Berufung erfolgt auf Vorschlag des Gerichtspräsidenten. Die Vorschriften über die Beisitzer der Wahlausschüsse in § 11 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes sowie in den §§ 5 und 10 dieser Verordnung gelten entsprechend.
(4) Die Wahlausschüsse bestehen auch nach der Hauptwahl, längstens bis zum Ablauf der Wahlperiode, fort.
§ 6 Wahlvorsteher und Wahlvorstand
(1) Vor jeder Wahl sind, nach Möglichkeit aus den Wahlberechtigten der Gemeinde, für jeden Wahlbezirk ein Wahlvorsteher und sein Stellvertreter, im Falle des § 46 Abs. 2 mehrere Wahlvorsteher und Stellvertreter zu ernennen.
(2) Die Beisitzer des Wahlvorstandes sollen möglichst aus den Wahlberechtigten der Gemeinde, nach Möglichkeit aus den Wahlberechtigten des Wahlbezirks berufen werden. Der Stellvertreter des Wahlvorstehers ist zugleich Beisitzer des Wahlvorstandes.
(3) Der Wahlvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Gemeindebehörde vor Beginn der Wahlhandlung auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hingewiesen. Die Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen während ihrer Tätigkeit kein auf eine politische Überzeugung hinweisendes Zeichen sichtbar tragen.
(4) Der Wahlvorsteher bestellt aus den Beisitzern den Schriftführer und dessen Stellvertreter. Ist nach § 9 Absatz 2 Satz 3 des Bundeswahlgesetzes angeordnet, dass die Beisitzer des Wahlvorstandes von der Gemeindebehörde berufen werden, so kann diese auch den Schriftführer und dessen Stellvertreter bestellen.
(5) Die Gemeindebehörde hat die Mitglieder des Wahlvorstandes vor der Wahl so über ihre Aufgaben zu unterrichten, dass ein ordnungsmäßiger Ablauf der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses gesichert ist.
(6) Der Wahlvorstand wird von der Gemeindebehörde oder in ihrem Auftrag vom Wahlvorsteher einberufen. Er tritt am Wahltage rechtzeitig vor Beginn der Wahlzeit im Wahlraum zusammen.
(7) Der Wahlvorstand sorgt für die ordnungsmäßige Durchführung der Wahl. Der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Wahlvorstandes.
(8) Während der Wahlhandlung müssen immer der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter sowie mindestens ein Beisitzer anwesend sein. Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend sein.
(9) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter sowie während der Wahlhandlung mindestens ein Beisitzer, bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses mindestens drei Beisitzer anwesend sind. Fehlende Beisitzer sind vom Wahlvorsteher durch Wahlberechtigte zu ersetzen, wenn es mit Rücksicht auf die Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes erforderlich ist. Sie sind vom Wahlvorsteher nach Absatz 3 auf ihre Verpflichtung hinzuweisen.
(10) Bei Bedarf stellt die Gemeindebehörde dem Wahlvorstand die erforderlichen Hilfskräfte zu Verfügung.
§ 9 Ehrenämter
Die Übernahme eines Wahlehrenamtes können ablehnen
1. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung,
2. Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder eines Landtages,
3. Wahlberechtigte, die am Wahltage das 65. Lebensjahr vollendet haben,
4. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderer Weise erschwert,
5. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden beruflichen Gründen oder durch Krankheit oder Behinderung oder aus einem sonstigen wichtigen Grunde gehindert sind, das Amt ordnungsmäßig auszuüben.
§ 12 Allgemeine Wahlbezirke
(1) Gemeinden mit nicht mehr als 2.500 Einwohnern bilden in der Regel einen Wahlbezirk. Größere Gemeinden werden in mehrere Wahlbezirke eingeteilt. Die Gemeindebehörde bestimmt, welche Wahlbezirke zu bilden sind.
(2) Die Wahlbezirke sollen nach den örtlichen Verhältnissen so abgegrenzt werden, dass allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Kein Wahlbezirk soll mehr als 2.500 Einwohner umfassen. Die Zahl der Wahlberechtigten eines Wahlbezirks darf nicht so gering sein, dass erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben.
(3) Die Wahlberechtigten in Gemeinschaftsunterkünften wie Lagern, Unterkünften der Bundeswehr, der Bundespolizei oder der Polizei sollen nach festen Abgrenzungsmerkmalen auf mehrere Wahlbezirke verteilt werden.
(4) Der Kreiswahlleiter kann kleine Gemeinden und Teile von Gemeinden des gleichen Verwaltungsbezirks zu einem Wahlbezirk und Teile von Gemeinden, die von Wahlkreisgrenzen durchschnitten werden, mit benachbarten Gemeinden oder Teilen von Gemeinden eines anderen Verwaltungsbezirks zu einem Wahlbezirk vereinigen. Dabei bestimmt er, welche Gemeinde die Wahl durchführt.
§ 13 Sonderwahlbezirke
(1) Für Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, Erholungsheime und gleichartige Einrichtungen mit einer größeren Anzahl von Wahlberechtigten, die keinen Wahlraum außerhalb der Einrichtung aufsuchen können, soll die Gemeindebehörde bei entsprechendem Bedürfnis Sonderwahlbezirke zur Stimmabgabe für Wahlscheininhaber bilden.
(2) Mehrere Einrichtungen können zu einem Sonderwahlbezirk zusammengefasst werden.
(3) Wird ein Sonderwahlbezirk nicht gebildet, gilt § 8 entsprechend.
§ 14 Führung des Wählerverzeichnisses
(1) Die Gemeindebehörde legt vor jeder Wahl für jeden allgemeinen Wahlbezirk (§ 12) ein Verzeichnis der Wahlberechtigten nach Familiennamen und Vornamen, Geburtsdatum und Wohnung an. Das Wählerverzeichnis kann auch im automatisierten Verfahren geführt werden.
(2) Das Wählerverzeichnis wird unter fortlaufender Nummer in der Buchstabenfolge der Familiennamen, bei gleichen Familiennamen der Vornamen, angelegt. Es kann auch nach Ortsteilen, Straßen und Hausnummern gegliedert werden. Es enthält je eine Spalte für Vermerke über die Stimmabgabe und für Bemerkungen.
(3) Die Gemeindebehörde sorgt dafür, dass die Unterlagen für die Wählerverzeichnisse jederzeit so vollständig vorhanden sind, dass diese vor Wahlen rechtzeitig angelegt werden können.
(4) Besteht ein Wahlbezirk aus mehreren Gemeinden oder Teilen mehrerer Gemeinden, so legt jede Gemeindebehörde das Wählerverzeichnis für ihren Teil des Wahlbezirks an.
§ 16 Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis
(1) Von Amts wegen sind in das Wählerverzeichnis alle Wahlberechtigten einzutragen, die am 42. Tage vor der Wahl (Stichtag) bei der Meldebehörde gemeldet sind
- für eine Wohnung,
2. auf Grund eines Anstellungs-, Heuer- oder Ausbildungsverhältnisses als Kapitän oder Besatzungsmitglied für ein Seeschiff, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen (§ 12 Abs. 4 Nr. 1 des Bundeswahlgesetzes),
3. für ein Binnenschiff, das in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist (§ 12 Abs. 4 Nr. 2 des Bundeswahlgesetzes),
4. für eine Justizvollzugsanstalt oder die entsprechende Einrichtung (§ 12 Abs. 4 Nr. 3 des Bundeswahlgesetzes).
(2) Auf Antrag sind in das Wählerverzeichnis einzutragen Wahlberechtigte
- nach § 12 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes,
a) (weggefallen)
b) die ohne eine Wohnung innezuhaben sich im Wahlgebiet sonst gewöhnlich aufhalten,
c) die sich in einer Justizvollzugsanstalt oder entsprechenden Einrichtung befinden und nicht nach Absatz 1 Nr. 4 von Amts wegen in das Wählerverzeichnis einzutragen sind,
2. nach § 12 Abs. 2 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes, die nicht nach Absatz 1 Nr. 1 von Amts wegen in das Wählerverzeichnis einzutragen sind.
(3) Verlegt ein Wahlberechtigter, der nach Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, seine Wohnung und meldet er sich vor Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerverzeichnis (§ 17 Abs. 1 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes) bei der Meldebehörde des Zuzugsortes an, so wird er in das Wählerverzeichnis der Gemeinde des Zuzugsortes nur auf Antrag eingetragen. Ein nach Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, der sich innerhalb derselben Gemeinde für eine Wohnung anmeldet, bleibt in dem Wählerverzeichnis des Wahlbezirks eingetragen, für den er am Stichtag gemeldet war. Der Wahlberechtigte ist bei der Anmeldung über die Regelung in den Sätzen 1 und 2 zu belehren. Erfolgt die Eintragung auf Antrag, benachrichtigt die Gemeindebehörde des Zuzugsortes hiervon unverzüglich die Gemeindebehörde des Fortzugsortes, die den Wahlberechtigten in ihrem Wählerverzeichnis streicht. Wenn im Falle des Satzes 1 bei der Gemeindebehörde des Fortzugsortes eine Mitteilung über den Ausschluss vom Wahlrecht vorliegt oder nachträglich eingeht, benachrichtigt sie hiervon unverzüglich die Gemeindebehörde des Zuzugsortes, die den Wahlberechtigten in ihrem Wählerverzeichnis streicht; der Betroffene ist von der Streichung zu unterrichten.
(4) Für Wahlberechtigte, die am Stichtag nicht für eine Wohnung gemeldet sind und sich vor dem Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerverzeichnis bei der Meldebehörde für eine Wohnung anmelden, gilt Absatz 3 Satz 1 und 3 entsprechend.
(5) Bezieht ein Wahlberechtigter, der nach Absatz 1 in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, in einer anderen Gemeinde eine weitere Wohnung, die seine Hauptwohnung wird, oder verlegt er seine Hauptwohnung in eine andere Gemeinde, so gilt, wenn er sich vor Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerverzeichnis bei der Meldebehörde anmeldet, Absatz 3 entsprechend.
(6) Welche von mehreren Wohnungen eines Wahlberechtigten seine Hauptwohnung ist, bestimmt sich nach § 21 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes.
(7) Bevor eine Person in das Wählerverzeichnis eingetragen wird, ist zu prüfen, ob sie die Wahlrechtsvoraussetzungen des § 12 des Bundeswahlgesetzes erfüllt und ob sie nicht nach § 13 des Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Soweit dies für die Prüfung der Wahlberechtigung eines Rückkehrers im Sinne des § 12 Absatz 2 Satz 3 Bundeswahlgesetz erforderlich ist, kann die Gemeindebehörde die Abgabe einer Versicherung an Eides statt zum Nachweis der Wahlberechtigung des Rückkehrers entsprechend § 18 Absatz 6 Satz 1 verlangen. Erfolgt die Eintragung in das Wählerverzeichnis nur auf Antrag, ist außerdem zu prüfen, ob ein frist- und formgerechter Antrag gestellt ist.
(8) Gibt eine Gemeindebehörde einem Eintragungsantrag nicht statt oder streicht sie eine in das Wählerverzeichnis eingetragene Person, hat sie den Betroffenen unverzüglich zu unterrichten. Gegen die Entscheidung kann der Betroffene Einspruch einlegen; er ist auf diese Möglichkeit hinzuweisen. § 22 Abs. 2, 4 und 5 gilt entsprechend. Die Frist für die Zustellung der Entscheidung (§ 22 Abs. 4 Satz 1) und für die Beschwerdeentscheidung (§ 22 Abs. 5 Satz 4) gilt nur, wenn der Einspruch vor dem zwölften Tage vor der Wahl eingelegt worden ist.
(9) Die Gemeindebehörde hat spätestens am Stichtag den Leiter der sich in ihrem Gemeindebezirk befindenden Justizvollzugsanstalt oder der entsprechenden Einrichtung auf Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe c und die Notwendigkeit der Unterrichtung der betroffenen Personen hinzuweisen, wenn nach § 27 Absatz 4 des Bundesmeldegesetzes eine Meldepflicht für die sich in den Einrichtungen aufhaltenden Personen nicht besteht.
§ 17 Zuständigkeiten für die Eintragung in das Wählerverzeichnis
(1) Zuständig für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist in den Fällen des
1. § 16 Abs. 1 Nr. 1 die für die Wohnung zuständige Gemeinde, bei mehreren Wohnungen die für die Hauptwohnung zuständige Gemeinde,
2. § 16 Abs. 1 Nr. 2 die für den Sitz des Reeders zuständige Gemeinde,
3. § 16 Abs. 1 Nr. 3 die für den Heimatort des Binnenschiffes zuständige Gemeinde,
4. § 16 Abs. 1 Nr. 4 die für die Justizvollzugsanstalt oder die entsprechende Einrichtung zuständige Gemeinde.
(2) Zuständig für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist in den Fällen des
1. (weggefallen)
2. § 16 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b die Gemeinde, in der der Wahlberechtigte seinen Antrag stellt,
3. § 16 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c die für die Justizvollzugsanstalt oder die entsprechende Einrichtung zuständige Gemeinde,
4. (weggefallen)
5. § 16 Abs. 2 Nr. 2 die Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland, in der der Wahlberechtigte nach seiner Erklärung vor seinem Fortzug aus dem Wahlgebiet zuletzt gemeldet war, wenn er im Wahlgebiet nie gemeldet war, die Gemeinde, der er nach seiner Erklärung im Sinne des § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes am engsten verbunden ist. Satz 1 gilt auch für Seeleute, die seit dem Fortzug aus dem Wahlgebiet auf Schiffen unter fremder Flagge fahren, sowie für Binnenschiffer, deren Schiff nicht in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist, und für die Angehörigen ihres Hausstandes. Für Seeleute, die von einem Seeschiff, das die Bundesflagge zu führen berechtigt war, abgemustert haben und im Anschluss daran auf einem Seeschiff unter fremder Flagge fahren, ist die Gemeinde am Sitz des ehemaligen Reeders zuständig. Für Binnenschiffer, die zuletzt auf einem in der Bundesrepublik Deutschland im Schiffsregister eingetragenen Binnenschiff gefahren sind und im Anschluss daran auf einem Binnenschiff, das nicht im Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen ist, oder auf einem Seeschiff unter fremder Flagge fahren, ist die Gemeinde nach Absatz 1 Nr. 3 zuständig.
(3) Zuständig für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist in den Fällen des
1. § 16 Abs. 3 die Gemeinde des Zuzugsortes,
2. § 16 Abs. 4 die Gemeinde, in der sich der Wahlberechtigte für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für die Hauptwohnung, gemeldet hat,
3. § 16 Abs. 5 die Gemeinde der neuen Hauptwohnung.
§ 18 Verfahren für die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag
(1) Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schriftlich bis spätestens zum 21. Tage vor der Wahl bei der zuständigen Gemeindebehörde zu stellen. Er muss den Familiennamen, die Vornamen, das Geburtsdatum und die genaue Anschrift des Wahlberechtigten enthalten. Sammelanträge sind, abgesehen von den Fällen des Absatzes 5, zulässig; sie müssen von allen aufgeführten Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich hierbei der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 57 gilt entsprechend.
(2) (weggefallen)
(3) In den Fällen des § 16 Abs. 2 Nr. 1 sind Wahlberechtigte bis zum Wahltage im Wählerverzeichnis der Gemeinde zu führen, die nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 zuständig ist, auch wenn nach dem Stichtag eine Neuanmeldung bei einer anderen Meldebehörde des Wahlgebietes erfolgt. Sie sind bei der Anmeldung entsprechend zu unterrichten.
(4) (weggefallen)
(5) In den Fällen des § 16 Abs. 2 Nr. 2 hat der Wahlberechtigte in seinem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis nach Anlage 2 der Gemeindebehörde gegenüber durch Abgabe einer Versicherung an Eides statt den Nachweis für seine Wahlberechtigung zu erbringen und zu erklären, dass er in keiner anderen Gemeinde im Wahlgebiet einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt hat. Vordrucke und Merkblätter für die Antragstellung können bei den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland, beim Bundeswahlleiter und bei den Kreiswahlleitern angefordert werden. Bestehen Zweifel an Angaben des Antragstellers, hat die Gemeindebehörde den Sachverhalt unverzüglich aufzuklären. Der Bundeswahlleiter ist von der Eintragung in das Wählerverzeichnis unverzüglich durch Übersendung der Zweitausfertigung des Antrages nach Anlage 2 oder einer Kopie der Erstausfertigung des Antrages nach Anlage 2, auf der die Eintragung in das Wählerverzeichnis vermerkt ist, zu unterrichten. Erhält der Bundeswahlleiter Mitteilungen verschiedener Gemeindebehörden über die Eintragung desselben Antragstellers in das Wählerverzeichnis, so hat er diejenige Gemeindebehörde, deren Unterrichtung über die Eintragung in das Wählerverzeichnis nach der ersten Mitteilung eingeht, unverzüglich von der Eintragung des Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis der zuerst mitteilenden Gemeinde zu benachrichtigen. Die vom Bundeswahlleiter benachrichtigte Gemeindebehörde hat den Wahlberechtigten im Wählerverzeichnis zu streichen und ihn davon zu unterrichten.
(6) Kehrt ein Wahlberechtigter nach § 12 Absatz 2 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes in das Wahlgebiet zurück und meldet er sich dort nach dem Stichtag nach § 16 Absatz 1, aber vor Beginn der Einsichtsfrist für das Wählerverzeichnis nach § 17 Absatz 1 Satz 2 Bundeswahlgesetz für eine Wohnung an, so wird er in das Wählerverzeichnis der Gemeinde des Zuzugsortes nur auf Antrag nach Anlage 1 eingetragen, mit dem er der Gemeindebehörde gegenüber durch Abgabe einer Versicherung an Eides statt den Nachweis für seine Wahlberechtigung erbringt und erklärt, dass er noch keinen anderen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt hat. Der Wahlberechtigte ist bei der Anmeldung darüber zu belehren. Die Gemeindebehörde hat den Bundeswahlleiter unverzüglich von der Eintragung eines solchen Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis durch Übersendung der Zweitausfertigung des Antrages nach Anlage 1 oder einer Kopie der Erstausfertigung des Antrages nach Anlage 1, auf der die Eintragung in das Wählerverzeichnis vermerkt ist, zu unterrichten. Absatz 5 Satz 5 und 6 gilt entsprechend.
§ 19 Benachrichtigung der Wahlberechtigten
(1) Spätestens am Tage vor der Bereithaltung des Wählerverzeichnisses zur Einsichtnahme benachrichtigt die Gemeindebehörde jeden Wahlberechtigten, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, nach dem Muster der Anlage 3. Die Mitteilung soll enthalten
- den Familiennamen, die Vornamen und die Wohnung des Wahlberechtigten,
2. die Angabe des Wahlraumes und ob dieser barrierefrei ist,
3. die Angabe der Wahlzeit,
4. die Nummer, unter der der Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen ist,
5. die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung zur Wahl mitzubringen und den Personalausweis oder Reisepass bereitzuhalten,
5a. die Belehrung, dass nach § 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben kann,
6. die Belehrung, dass die Wahlbenachrichtigung einen Wahlschein nicht ersetzt und daher nicht zur Wahl in einem anderen als dem angegebenen Wahlraum berechtigt,
7. einen Hinweis, wo Wahlberechtigte Informationen über barrierefreie Wahlräume und Hilfsmittel erhalten können,
8. die Belehrung über die Beantragung eines Wahlscheines und über die Übersendung von Briefwahlunterlagen. Sie muss mindestens Hinweise darüber enthalten,
a) dass der Wahlscheinantrag nur auszufüllen ist, wenn der Wahlberechtigte in einem anderen Wahlraum seines Wahlkreises oder durch Briefwahl wählen will,
b) unter welchen Voraussetzungen ein Wahlschein erteilt wird (§ 25 Abs. 1 und § 27 Abs. 4 Satz 3) und
c) dass der Wahlschein von einem anderen als dem Wahlberechtigten nur beantragt werden kann, wenn die Berechtigung zur Antragstellung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird (§ 27 Abs. 3).
Erfolgt die Eintragung eines Wahlberechtigten, der nach § 16 Abs. 2 bis 5 auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wird, nach der Versendung der Benachrichtigungen gemäß Satz 1, hat dessen Benachrichtigung unverzüglich nach der Eintragung zu erfolgen.
(2) Auf die Rückseite der Benachrichtigung nach Absatz 1 ist ein Vordruck für einen Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines mit Briefwahlunterlagen nach dem Muster der Anlage 4 aufzudrucken.
(3) Auf Wahlberechtigte, die nach § 16 Abs. 2 nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung.
(4) Stellt ein Landeswahlleiter fest, dass die fristgemäße Benachrichtigung nach Absatz 1 infolge von Naturkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt gestört ist, bestimmt er, dass sie in dem betroffenen Gebiet später erfolgen kann. Wenn zu besorgen ist, dass die Benachrichtigung nach Absatz 1 nicht bis zum sechsten Tag vor der Wahl erfolgen kann, bestimmt er, dass die Wahlberechtigten in anderer geeigneter Weise über die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2, 3, 5 bis 7 zu benachrichtigen sind. Der Landeswahlleiter kann hierzu im Einzelfall ergänzende Regelungen zur Anpassung an die besonderen Verhältnisse treffen. Er macht die Gründe für die Störung, das betroffene Gebiet, die von ihm für den Einzelfall getroffenen Regelungen und die Art der Benachrichtigung in geeigneter Weise bekannt.
§ 20 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
(1) Die Gemeindebehörde macht spätestens am 24. Tage vor der Wahl nach dem Muster der Anlage 5 öffentlich bekannt,
1. von wem, zu welchen Zwecken und unter welchen Voraussetzungen, wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden das Wählerverzeichnis eingesehen werden kann und ob der Ort der Einsichtnahme barrierefrei ist,
2. dass bei der Gemeindebehörde innerhalb der Einsichtsfrist schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift Einspruch gegen das Wählerverzeichnis eingelegt werden kann (§ 22),
3. dass Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis spätestens zum 21. Tage vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung zugeht und dass Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, keine Wahlbenachrichtigung erhalten,
4. wo, in welcher Zeit und unter welchen Voraussetzungen Wahlscheine beantragt werden können (§§ 25ff.),
5. wie durch Briefwahl gewählt wird (§ 66).
(2) Die diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland machen unverzüglich nach der Bestimmung des Wahltages öffentlich bekannt,
- unter welchen Voraussetzungen im Ausland lebende Deutsche an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen können,
2. wo, in welcher Form und in welcher Frist dieser Personenkreis, um an der Wahl teilnehmen zu können, die Eintragung in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland beantragen muss.
Die Bekanntmachung ist nach Anlage 6 von den Botschaften durch mindestens eine deutschsprachige Anzeige in einer überregionalen Tages- oder Wochenzeitung vorzunehmen; zusätzlich kann der Inhalt der Bekanntmachung von den Berufskonsulaten, wenn dies nach den örtlichen Verhältnissen angezeigt ist, durch deutschsprachige Anzeigen in regionalen Tageszeitungen sowie von den Botschaften und Berufskonsulaten im Internet veröffentlicht werden. Kann die Bekanntmachung in begründeten Einzelfällen nicht erfolgen oder erscheint sie nicht gerechtfertigt, so ist sie durch Aushang im Dienstgebäude der Vertretung und, soweit möglich, durch Unterrichtung der einzelnen bekannten Betroffenen vorzunehmen.
§ 21 Einsicht in das Wählerverzeichnis
(1) Die Gemeindebehörde hält das Wählerverzeichnis mindestens am Ort der Gemeindeverwaltung während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereit. Wird das Wählerverzeichnis im automatisierten Verfahren geführt, kann die Einsichtnahme durch ein Datensichtgerät ermöglicht werden. Es ist sicherzustellen, dass Bemerkungen (§ 23 Abs. 3) im Klartext gelesen werden können. Das Datensichtgerät darf nur von einem Bediensteten der Gemeindebehörde bedient werden.
(2) (weggefallen)
(3) Innerhalb der Einsichtsfrist ist das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
§ 22 Einspruch gegen das Wählerverzeichnis und Beschwerde
(1) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist Einspruch einlegen.
(2) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindebehörde einzulegen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der Einspruchsführer die erforderlichen Beweismittel beizubringen. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich hierbei der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 57 gilt entsprechend.
(3) Will die Gemeindebehörde einem Einspruch gegen die Eintragung eines anderen stattgeben, so hat sie diesem vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(4) Die Gemeindebehörde hat ihre Entscheidung dem Einspruchsführer und dem Betroffenen spätestens am zehnten Tage vor der Wahl zuzustellen und auf den zulässigen Rechtsbehelf hinzuweisen. Einem auf Eintragung gerichteten Einspruch gibt die Gemeindebehörde in der Weise statt, dass sie dem Wahlberechtigten nach Berichtigung des Wählerverzeichnisses die Wahlbenachrichtigung zugehen lässt. In den Fällen des § 18 Abs. 5 und 6 unterrichtet sie unverzüglich die zuständigen Stellen von der Eintragung.
(5) Gegen die Entscheidung der Gemeindebehörde kann binnen zwei Tagen nach Zustellung Beschwerde an den Kreiswahlleiter eingelegt werden. Die Beschwerde ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindebehörde einzulegen. Die Gemeindebehörde legt die Beschwerde mit den Vorgängen unverzüglich dem Kreiswahlleiter vor. Der Kreiswahlleiter hat über die Beschwerde spätestens am vierten Tage vor der Wahl zu entscheiden; Absatz 3 gilt entsprechend. Die Beschwerdeentscheidung ist den Beteiligten und der Gemeindebehörde bekannt zu geben. Sie ist vorbehaltlich anderer Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren endgültig.
§ 23 Berichtigung des Wählerverzeichnisses
(1) Nach Beginn der Einsichtsfrist ist die Eintragung oder Streichung von Personen sowie die Vornahme sonstiger Änderungen im Wählerverzeichnis nur noch auf rechtzeitigen Einspruch zulässig. § 16 Abs. 2 bis 5, § 18 Abs. 5 Satz 6 und Abs. 6 Satz 4 sowie § 30 bleiben unberührt.
(2) Ist das Wählerverzeichnis offensichtlich unrichtig oder unvollständig, so kann die Gemeindebehörde den Mangel auch von Amts wegen beheben. Dies gilt nicht für Mängel, die Gegenstand eines Einspruchsverfahrens sind. § 22 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. Die Frist für die Zustellung der Entscheidung (§ 22 Abs. 4 Satz 1) und für die Beschwerdeentscheidung (§ 22 Abs. 5 Satz 4) gilt nur, wenn die von Amts wegen behebbaren Mängel vor dem zwölften Tage vor der Wahl bekannt werden.
(3) Alle vom Beginn der Einsichtsfrist ab vorgenommenen Änderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ zu erläutern und mit Datum und Unterschrift des vollziehenden Bediensteten, im automatisierten Verfahren anstelle der Unterschrift mit einem Hinweis auf den verantwortlichen Bediensteten zu versehen.
(4) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses können Änderungen mit Ausnahme der in Absatz 2 und in § 53 Abs. 2 vorgesehenen Berichtigungen nicht mehr vorgenommen werden.
§ 24 Abschluss des Wählerverzeichnisses
(1) Das Wählerverzeichnis ist spätestens am Tage vor der Wahl, jedoch nicht früher als am dritten Tage vor der Wahl, durch die Gemeindebehörde abzuschließen. Sie stellt dabei die Zahl der Wahlberechtigten des Wahlbezirks fest. Der Abschluss wird nach dem Muster der Anlage 8 beurkundet. Bei automatisierter Führung des Wählerverzeichnisses ist vor der Beurkundung ein Ausdruck herzustellen.
(2) Wählerverzeichnisse mehrerer Gemeinden oder Gemeindeteile, die zu einem Wahlbezirk vereinigt sind, werden von der Gemeindebehörde, die die Wahl im Wahlbezirk durchführt, zum Wählerverzeichnis des Wahlbezirks verbunden und abgeschlossen.
§ 25 Voraussetzungen für die Erteilung von Wahlscheinen
(1) Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.
(2) Ein Wahlberechtigter, der nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein,
1. wenn er nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 oder die Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 versäumt hat,
2. wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Fristen nach § 18 Abs. 1 oder § 22 Abs. 1 entstanden ist,
3. wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.
§ 26 Zuständige Behörde, Form des Wahlscheines
Der Wahlschein wird nach dem Muster der Anlage 9 von der Gemeindebehörde erteilt, in deren Wählerverzeichnis der Wahlberechtigte eingetragen ist oder hätte eingetragen werden müssen.
§ 27 Wahlscheinanträge
(1) Die Erteilung eines Wahlscheines kann schriftlich oder mündlich bei der Gemeindebehörde beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 57 gilt entsprechend.
(2) Der Antragsteller muss den Familiennamen, die Vornamen, das Geburtsdatum und seine Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben.
(3) Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
(4) Wahlscheine können bis zum zweiten Tage vor der Wahl, 18.00 Uhr, beantragt werden. In den Fällen des § 25 Abs. 2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann; in diesem Fall hat die Gemeindebehörde vor Erteilung des Wahlscheines den für den Wahlbezirk des Wahlberechtigten zuständigen Wahlvorsteher davon zu unterrichten, der entsprechend § 53 Abs. 2 zu verfahren hat.
(5) Bei Wahlberechtigten, die nach § 16 Abs. 2 nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden, gilt der Antrag zugleich als Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines, es sei denn, der Wahlberechtigte will vor dem Wahlvorstand seines Wahlbezirks wählen.
(6) Verspätet eingegangene schriftliche Anträge sind unbearbeitet mit den dazugehörigen Briefumschlägen zu verpacken und vorläufig aufzubewahren.
§ 28 Erteilung von Wahlscheinen
(1) Wahlscheine dürfen nicht vor Zulassung der Wahlvorschläge durch den Landes- und den Kreiswahlausschuss nach den §§ 26 und 28 des Bundeswahlgesetzes erteilt werden.
(2) Der Wahlschein muss von dem mit der Erteilung beauftragten Bediensteten eigenhändig unterschrieben werden und mit dem Dienstsiegel versehen sein. Das Dienstsiegel kann eingedruckt werden. Wird der Wahlschein mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellt, kann abweichend von Satz 1 die Unterschrift fehlen; stattdessen kann der Name des beauftragten Bediensteten eingedruckt werden.
(3) Dem Wahlschein sind beizufügen
1. ein amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises nach dem Muster der Anlage 26,
2. ein amtlicher Stimmzettelumschlag nach dem Muster der Anlage 10,
3. ein amtlicher Wahlbriefumschlag nach dem Muster der Anlage 11, auf dem die vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden ist (Wahlbriefempfänger gemäß § 66 Absatz 2), sowie die Bezeichnung der Gemeindebehörde, die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk von der Ausgabestelle voreingetragen sind, und
4. ein Merkblatt zur Briefwahl nach dem Muster der Anlage 12.
Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 29 Absatz 1.
(4) Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden dem Wahlberechtigten an seine Wohnanschrift übersandt oder amtlich überbracht, soweit sich aus dem Antrag keine andere Anschrift oder die Abholung der Unterlagen ergibt. Wird die Versendung an eine andere Anschrift in einer Form nach § 27 Absatz 1 Satz 2 beantragt, gehört zur Versendung der Briefwahlunterlagen die gleichzeitige Versendung einer Mitteilung an die Wohnanschrift. Postsendungen sind von der Gemeindebehörde freizumachen. Die Gemeindebehörde übersendet dem Wahlberechtigten Wahlschein und Briefwahlunterlagen mit Luftpost, wenn sich aus seinem Antrag ergibt, dass er aus einem außereuropäischen Gebiet wählen will, oder wenn dieses sonst geboten erscheint.
(5) Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen bei der Gemeindebehörde ab, so soll ihm Gelegenheit gegeben werden, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. Es ist sicherzustellen, dass der Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden kann. An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. § 27 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor der Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
(6) Über die erteilten Wahlscheine führt die Gemeindebehörde ein Wahlscheinverzeichnis, in dem die Fälle des § 25 Abs. 1 und die des Absatzes 2 getrennt gehalten werden. Das Verzeichnis wird als Liste oder als Sammlung der Durchschriften der Wahlscheine geführt. Auf dem Wahlschein wird die Nummer eingetragen, unter der er im Wahlscheinverzeichnis vermerkt ist, sowie die Nummer, unter der der Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis geführt wird, oder der vorgesehene Wahlbezirk. Bei nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten wird auf dem Wahlschein vermerkt, dass dessen Erteilung nach § 25 Abs. 2 erfolgt ist und welchem Wahlbezirk der Wahlberechtigte zugeordnet wird. Werden nach Abschluss des Wählerverzeichnisses noch Wahlscheine erteilt, so ist darüber ein besonderes Verzeichnis nach den Sätzen 1 bis 3 zu führen.
(7) Wird einem Wahlberechtigten ein Wahlschein nach § 25 Abs. 2 erteilt, hat die Gemeindebehörde bei Wahlberechtigten nach § 12 Abs. 2 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes unverzüglich den Bundeswahlleiter zu unterrichten. § 18 Abs. 5 Satz 5 und 6 gilt entsprechend.
(8) Wird ein Wahlberechtigter, der bereits einen Wahlschein erhalten hat, im Wählerverzeichnis gestrichen, so ist der Wahlschein für ungültig zu erklären. Die Gemeindebehörde führt darüber ein Verzeichnis, in das der Name des Wahlberechtigten und die Nummer des für ungültig erklärten Wahlscheines aufzunehmen ist; sie hat das Wahlscheinverzeichnis zu berichtigen. Die Gemeindebehörde verständigt den Kreiswahlleiter, der alle Wahlvorstände des Wahlkreises über die Ungültigkeit des Wahlscheines unterrichtet. In den Fällen des § 39 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes ist im Wahlscheinverzeichnis und im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine in geeigneter Form zu vermerken, dass die Stimme eines Wählers, der bereits an der Briefwahl teilgenommen hat, nicht ungültig ist.
(9) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses übersendet die Gemeindebehörde, sofern sie nicht selbst oder eine andere Gemeindebehörde oder die Verwaltungsbehörde des Kreises für die Durchführung der Briefwahl zuständig ist, dem Kreiswahlleiter auf schnellstem Wege das Verzeichnis nach Absatz 8 Satz 2 und Nachträge zu diesem Verzeichnis oder eine Mitteilung, dass Wahlscheine nicht für ungültig erklärt worden sind, so rechtzeitig, dass sie dort spätestens am Wahltage vormittags eingehen. Ist eine andere Gemeindebehörde nach § 7 Nr. 3 mit der Durchführung der Briefwahl betraut worden oder ist die Verwaltungsbehörde des Kreises zuständig, hat die Gemeindebehörde das Verzeichnis und die Nachträge oder eine Mitteilung entsprechend Satz 1 der beauftragten Gemeindebehörde oder der Verwaltungsbehörde des Kreises zu übersenden.
(10) Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden; Absatz 8 Satz 1 bis 3 und Absatz 9 gelten entsprechend.
§ 29 Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte Personengruppen
(1) Die Gemeindebehörde fordert spätestens am achten Tage vor der Wahl von den Leitungen
- der Einrichtungen, für die ein Sonderwahlbezirk gebildet worden ist (§ 13),
2. der kleineren Krankenhäuser, kleineren Alten- oder Pflegeheime, Klöster, sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten, für deren Wahlberechtigte die Stimmabgabe vor einem beweglichen Wahlvorstand vorgesehen ist (§§ 8 und 62 bis 64),
ein Verzeichnis der wahlberechtigten Personen aus der Gemeinde, die sich in der Einrichtung befinden oder dort beschäftigt sind und die am Wahltage in der Einrichtung wählen wollen. Sie erteilt diesen Wahlberechtigten Wahlscheine ohne Briefwahlunterlagen und übersendet sie unmittelbar an diese.
(2) Die Gemeindebehörde veranlasst die Leitungen der Einrichtungen spätestens am 13. Tage vor der Wahl,
1. die wahlberechtigten Personen, die sich in der Einrichtung befinden oder dort beschäftigt sind und die in Wählerverzeichnissen anderer Gemeinden des gleichen Wahlkreises geführt werden, zu verständigen, dass sie in der Einrichtung nur wählen können, wenn sie sich von der Gemeindebehörde, in deren Wählerverzeichnis sie eingetragen sind, einen Wahlschein beschafft haben,
2. die wahlberechtigten Personen, die sich in der Einrichtung befinden oder dort beschäftigt sind und die in Wählerverzeichnissen von Gemeinden anderer Wahlkreise geführt werden, zu verständigen, dass sie ihr Wahlrecht nur durch Briefwahl in ihrem Heimatwahlkreis ausüben können und sich dafür von der Gemeindebehörde, in deren Wählerverzeichnis sie eingetragen sind, einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beschaffen müssen.
(3) Die Gemeindebehörde ersucht spätestens am 13. Tage vor der Wahl die Truppenteile, die ihren Standort im Gemeindegebiet haben, die wahlberechtigten Soldaten entsprechend Absatz 2 Nr. 2 zu verständigen.
§ 30 Vermerk im Wählerverzeichnis
Hat ein Wahlberechtigter einen Wahlschein erhalten, so wird im Wählerverzeichnis in der Spalte für den Vermerk über die Stimmabgabe „Wahlschein“ oder „W“ eingetragen.
§ 34 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge
(1) Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 eingereicht werden. Er muss enthalten
- den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers,
2. den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 des Bundeswahlgesetzes) deren Kennwort.
Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.
(2) Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in einem Land keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt.
(3) Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13) selbst zu leisten. Absatz 4 Nr. 3 und 4 gilt entsprechend.
(4) Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:
1. Der Kreiswahlleiter liefert die Formblätter auf Anforderung kostenfrei; er kann sie auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 des Bundeswahlgesetzes zu bestätigen. Der Kreiswahlleiter hat die in den Sätzen 2 bis 4 genannten Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.
2. Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Von Wahlberechtigten im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes ist der Nachweis für die Wahlberechtigung durch die Angaben gemäß Anlage 2 und Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen.
3. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der Gemeindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt.
4. Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig.
5. Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig.
(5) Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen
1. die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat,
2. eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist,
3. bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien
a) eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt; die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 abgegeben werden;
b) eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der Anlage 15, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für die Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 des Bundeswahlgesetzes entsprechend,
4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (Absatz 4 Nr. 2 und 3), sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss.
(6) Die Bescheinigung des Wahlrechts (Absatz 4 Nr. 3) und die Bescheinigung der Wählbarkeit (Absatz 5 Nr. 2) sind kostenfrei zu erteilen. Die Gemeindebehörde darf für jeden Wahlberechtigten die Bescheinigung des Wahlrechts nur einmal zu einem Kreiswahlvorschlag erteilen; dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist.
(7) Für Bewerber, die keine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehaben und sich dort auch sonst nicht gewöhnlich aufhalten, erteilt das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat die Wählbarkeitsbescheinigung. Sie ist bei der für den Wohnort des Bewerbers zuständigen diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland, sonst unmittelbar unter Vorlage der erforderlichen Nachweise zu beantragen.
35 Vorprüfung der Kreiswahlvorschläge durch den Kreiswahlleiter
(1) Der Kreiswahlleiter vermerkt auf jedem Kreiswahlvorschlag den Tag und bei Eingang am letzten Tage der Einreichungsfrist außerdem die Uhrzeit des Eingangs und übersendet dem Landeswahlleiter und dem Bundeswahlleiter sofort je einen Abdruck. Er prüft unverzüglich, ob die eingegangenen Kreiswahlvorschläge vollständig sind und den Erfordernissen des Bundeswahlgesetzes und dieser Verordnung entsprechen.
(2) Wird dem Kreiswahlleiter bekannt, dass ein im Wahlkreis vorgeschlagener Bewerber noch in einem anderen Wahlkreis vorgeschlagen worden ist, so weist er den Kreiswahlleiter des anderen Wahlkreises auf die Doppelbewerbung hin.
(3) Wird der Kreiswahlausschuss nach § 25 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes im Mängelbeseitigungsverfahren angerufen, hat er über die Verfügung des Kreiswahlleiters unverzüglich zu entscheiden. Der Vertrauensperson des betroffenen Kreiswahlvorschlages ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
§ 39 Inhalt und Form der Landeslisten
(1) Die Landesliste soll nach dem Muster der Anlage 20 eingereicht werden. Sie muss enthalten
- den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese,
2. den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber.
Sie soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.
(2) Die Landesliste ist von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in einem Land keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so ist die Landesliste von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, die im Bereich des Landes liegen, dem Satz 1 gemäß zu unterzeichnen. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände beibringt.
(3) Die in § 18 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes genannten Parteien haben die nach § 27 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes weiter erforderliche Zahl von Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 21 zu erbringen. Der Landeswahlleiter liefert die Formblätter auf Anforderung kostenfrei; er kann sie auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung ist der Name der Partei, die die Landesliste einreichen will, und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese anzugeben. Der Landeswahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. Im Übrigen gilt § 34 Abs. 4 entsprechend.
(4) Der Landesliste sind beizufügen
1. die Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerber, dass sie ihrer Aufstellung zustimmen und für keine andere Landesliste ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben haben, sowie eine Versicherung an Eides statt gegenüber dem Landeswahlleiter, dass sie nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei sind, jeweils nach dem Muster der Anlage 22; für die Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 des Bundeswahlgesetzes entsprechend,
2. die Bescheinigungen der zuständigen Gemeindebehörden nach dem Muster der Anlage 16, dass die vorgeschlagenen Bewerber wählbar sind,
3. eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Bewerber aufgestellt worden sind und ihre Reihenfolge auf der Landesliste festgelegt worden ist, mit der nach § 21 Abs. 6 des Bundeswahlgesetzes vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt, wobei sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken hat, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber in der Landesliste in geheimer Abstimmung erfolgt ist; die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 23 gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 24 abgegeben werden,
4. die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (Absatz 3 Satz 5), sofern es sich um einen Landeswahlvorschlag einer in § 18 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes genannten Partei handelt.
(5) § 34 Abs. 6 und 7 gilt entsprechend.
§ 40 Vorprüfung der Landeslisten durch den Landeswahlleiter
(1) Der Landeswahlleiter vermerkt auf jeder Landesliste den Tag und bei Eingang am letzten Tage der Einreichungsfrist außerdem die Uhrzeit des Eingangs und übersendet dem Bundeswahlleiter sofort einen Abdruck. Er prüft unverzüglich, ob die eingegangenen Landeslisten vollständig sind und den Erfordernissen des Bundeswahlgesetzes und dieser Verordnung entsprechen.
(2) Wird dem Landeswahlleiter bekannt, dass ein auf einer Landesliste vorgeschlagener Bewerber noch auf einer anderen Landesliste vorgeschlagen worden ist, so weist er den Landeswahlleiter des anderen Landes auf die Doppelbewerbung hin.
(3) Wird der Landeswahlausschuss nach § 27 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes in Verbindung mit § 25 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes im Mängelbeseitigungsverfahren angerufen, gilt § 35 Abs. 3 entsprechend.
§ 48 Wahlbekanntmachung der Gemeindebehörde
(1) Die Gemeindebehörde macht spätestens am sechsten Tage vor der Wahl nach dem Muster der Anlage 27 Beginn und Ende der Wahlzeit sowie die Wahlbezirke und Wahlräume öffentlich bekannt; an Stelle der Aufzählung der Wahlbezirke mit ihrer Abgrenzung und ihren Wahlräumen kann auf die Angaben in der Wahlbenachrichtigung verwiesen werden. Dabei weist die Gemeindebehörde darauf hin,
1. dass der Wähler eine Erststimme und eine Zweitstimme hat,
2. dass die Stimmzettel amtlich hergestellt und im Wahlraum bereitgehalten werden,
3. welchen Inhalt der Stimmzettel hat und wie er zu kennzeichnen ist,
4. in welcher Weise mit Wahlschein und insbesondere durch Briefwahl gewählt werden kann,
5. dass nach § 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes jeder Wahlberechtigte sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben kann und eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten unzulässig ist,
5a. dass nach § 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen kann, die Hilfeleistung auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt und eine Hilfeleistung unzulässig ist, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht,
6. dass nach § 107a Absatz 1 des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht und unbefugt auch wählt, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt, sowie dass nach § 107a Absatz 3 des Strafgesetzbuches auch der Versuch strafbar ist.
(2) Die Wahlbekanntmachung oder ein Auszug aus ihr mit den Nummern 1, 3, 4 und 6 der Anlage 27 ist vor Beginn der Wahlhandlung am oder im Eingang des Gebäudes, in dem sich der Wahlraum befindet, anzubringen. Dem Auszug ist ein Stimmzettel als Muster beizufügen.
§ 53 Eröffnung der Wahlhandlung
(1) Der Wahlvorsteher eröffnet die Wahlhandlung damit, dass er die anwesenden Beisitzer auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten hinweist. Er stellt sicher, dass der Hinweis allen Beisitzern vor Aufnahme ihrer Tätigkeit erteilt wird.
(2) Vor Beginn der Stimmabgabe berichtigt der Wahlvorsteher das Wählerverzeichnis nach dem Verzeichnis der etwa nachträglich ausgestellten Wahlscheine (§ 28 Abs. 6 Satz 5), indem er bei den in diesem Verzeichnis aufgeführten Wahlberechtigten in der Spalte für den Stimmabgabevermerk „Wahlschein“ oder „W“ einträgt. Er berichtigt dementsprechend die Abschlussbescheinigung des Wählerverzeichnisses in der daneben vorgesehenen Spalte und bescheinigt das an der vorgesehenen Stelle. Erhält der Wahlvorsteher später die Mitteilung von der Ausstellung von Wahlscheinen nach § 27 Abs. 4 Satz 3, verfährt er entsprechend den Sätzen 1 und 2.
(3) Der Wahlvorstand überzeugt sich vor Beginn der Stimmabgabe davon, dass die Wahlurne leer ist. Der Wahlvorsteher verschließt die Wahlurne. Sie darf bis zum Schluss der Wahlhandlung nicht mehr geöffnet werden.
§ 57 Stimmabgabe von Wählern mit Behinderungen
(1) Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder der wegen einer Behinderung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu werfen, bestimmt eine andere Person, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will, und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes sein.
(2) Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.
(3) Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlkabine aufsuchen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl eines anderen erlangt hat.
(4) Ein blinder oder sehbehinderter Wähler kann sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer Stimmzettelschablone bedienen.
§ 61 Wahl in Sonderwahlbezirken
(1) Zur Stimmabgabe in Sonderwahlbezirken (§ 13) wird jeder in der Einrichtung anwesende Wahlberechtigte zugelassen, der einen für den Wahlkreis gültigen Wahlschein hat.
(2) Es ist zulässig, für die verschiedenen Teile eines Sonderwahlbezirks verschiedene Personen als Beisitzer des Wahlvorstandes zu bestellen.
(3) Die Gemeindebehörde bestimmt im Einvernehmen mit der Leitung der Einrichtung einen geeigneten Wahlraum. Für die verschiedenen Teile eines Sonderwahlbezirks können verschiedene Wahlräume bestimmt werden. Die Gemeindebehörde richtet den Wahlraum her.
(4) Die Gemeindebehörde bestimmt die Wahlzeit für den Sonderwahlbezirk im Einvernehmen mit der Leitung der Einrichtung im Rahmen der allgemeinen Wahlzeit nach dem tatsächlichen Bedürfnis.
(5) Die Leitung der Einrichtung gibt den Wahlberechtigten den Wahlraum und die Wahlzeit am Tage vor der Wahl bekannt und weist auf die Möglichkeit der Stimmabgabe nach Absatz 6 hin.
(6) Der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter und zwei Beisitzer können sich unter Mitnahme einer verschlossenen Wahlurne und der erforderlichen Stimmzettel auch in die Krankenzimmer und an die Krankenbetten begeben. Dort nehmen sie die Wahlscheine entgegen und verfahren nach den §§ 59 und 56 Abs. 4 bis 8. Dabei muss auch bettlägerigen Wählern Gelegenheit gegeben werden, ihre Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen und zu falten. Der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter weist Wähler, die sich bei der Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen wollen, darauf hin, dass sie auch ein von ihnen bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes als Hilfsperson in Anspruch nehmen können. Nach Schluss der Stimmabgabe sind die verschlossene Wahlurne und die Wahlscheine unverzüglich in den Wahlraum des Sonderwahlbezirks zu bringen. Dort ist die Wahlurne bis zum Schluss der allgemeinen Stimmabgabe unter Aufsicht des Wahlvorstandes verschlossen zu verwahren. Danach wird ihr Inhalt mit dem Inhalt der allgemeinen Wahlurne vermengt und zusammen mit den übrigen Stimmen des Sonderwahlbezirks ausgezählt. Der Vorgang ist in der Wahlniederschrift zu vermerken.
(7) Die Öffentlichkeit der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses soll noch Möglichkeit durch die Anwesenheit anderer Wahlberechtigter gewährleistet werden.
(8) Die Leitung der Einrichtung hat bei Kranken mit ansteckenden Krankheiten insbesondere § 30 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes zu beachten.
(9) Das Wahlergebnis des Sonderwahlbezirks darf nicht vor Schluss der allgemeinen Wahlzeit ermittelt werden.
(10) Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.
§ 62 Stimmabgabe in kleineren Krankenhäusern und kleineren Alten- oder Pflegeheimen
(1) Die Gemeindebehörde soll bei entsprechendem Bedürfnis und soweit möglich im Benehmen mit der Leitung eines kleineren Krankenhauses oder eines kleineren Alten- oder Pflegeheimes zulassen, dass dort anwesende Wahlberechtigte, die einen für den Wahlkreis gültigen Wahlschein besitzen, vor einem beweglichen Wahlvorstand (§ 8) wählen.
(2) Die Gemeindebehörde vereinbart mit der Leitung der Einrichtung die Zeit der Stimmabgabe innerhalb der allgemeinen Wahlzeit. Die Leitung der Einrichtung stellt, soweit erforderlich, einen geeigneten Wahlraum bereit. Die Gemeindebehörde richtet ihn her. Die Leitung der Einrichtung gibt den Wahlberechtigten Ort und Zeit der Stimmabgabe bekannt.
(3) Der bewegliche Wahlvorstand begibt sich unter Mitnahme einer verschlossenen Wahlurne und der erforderlichen Stimmzettel in das Krankenhaus oder in das Alten- oder Pflegeheim, nimmt die Wahlscheine entgegen und verfährt nach den §§ 59 und 56 Abs. 4 bis 8. Der Wahlvorsteher oder sein Stellvertreter weist Wähler, die sich bei der Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen wollen, darauf hin, dass sie auch ein von ihnen bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes als Hilfsperson in Anspruch nehmen können. Nach Schluss der Stimmabgabe sind die verschlossene Wahlurne und die Wahlscheine unverzüglich in den Wahlraum des Wahlbezirks zu bringen. Dort ist die Wahlurne bis zum Schluss der allgemeinen Stimmabgabe unter Aufsicht des Wahlvorstandes verschlossen zu verwahren. Danach wird ihr Inhalt mit dem Inhalt der allgemeinen Wahlurne vermengt und zusammen mit den Stimmen des Wahlbezirks ausgezählt. Der Vorgang ist in der Wahlniederschrift zu vermerken.
(4) § 61 Abs. 6 bis 8 gilt entsprechend. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.
§ 64 Stimmabgabe in sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten
(1) In sozialtherapeutischen Anstalten und Justizvollzugsanstalten soll die Gemeindebehörde bei entsprechendem Bedürfnis und soweit möglich Gelegenheit geben, dass die in der Anstalt anwesenden Wahlberechtigten, die einen für den Wahlkreis gültigen Wahlschein besitzen, in der Anstalt vor einem beweglichen Wahlvorstand (§ 8) wählen.
(2) Die Gemeindebehörde vereinbart mit der Leitung der Anstalt die Zeit der Stimmabgabe innerhalb der allgemeinen Wahlzeit. Die Anstaltsleitung stellt einen Wahlraum bereit. Die Gemeindebehörde richtet ihn her. Die Anstaltsleitung gibt den Wahlberechtigten Ort und Zeit der Stimmabgabe bekannt und sorgt dafür, dass sie zur Stimmabgabe den Wahlraum aufsuchen können.
(3) § 62 Abs. 3 und § 61 Abs. 6 bis 8 gelten entsprechend. Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen.
§ 67 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk
Im Anschluss an die Wahlhandlung ermittelt der Wahlvorstand vorbehaltlich § 68 Absatz 2 ohne Unterbrechung das Wahlergebnis im Wahlbezirk und stellt fest
1. die Zahl der Wahlberechtigten,
2. die Zahl der Wähler,
3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Erststimmen,
4. die Zahlen der gültigen und ungültigen Zweitstimmen,
5. die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Erststimmen,
6. die Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Zweitstimmen.
§ 71 Schnellmeldungen, vorläufige Wahlergebnisse
(1) Sobald das Wahlergebnis im Wahlbezirk festgestellt ist, meldet es der Wahlvorsteher der Gemeindebehörde, die die Wahlergebnisse aller Wahlbezirke der Gemeinde zusammenfasst und dem Kreiswahlleiter meldet. Ist in der Gemeinde nur ein Wahlbezirk gebildet, meldet der Wahlvorsteher das Wahlergebnis dem Kreiswahlleiter. Der Landeswahlleiter kann anordnen, dass die Wahlergebnisse in den kreisangehörigen Gemeinden über die Verwaltungsbehörde des Kreises gemeldet werden.
(2) Die Meldung wird auf schnellstem Wege (z. B. telefonisch oder auf sonstigem elektronischen Wege) erstattet. Sie enthält die Zahlen
- der Wahlberechtigten,
2. der Wähler,
3. der gültigen und ungültigen Erststimmen,
4. der gültigen und ungültigen Zweitstimmen,
5. der für jeden Bewerber abgegebenen gültigen Erststimmen,
6. der für jede Landesliste abgegebenen gültigen Zweitstimmen.
(3) Der Kreiswahlleiter ermittelt nach den Schnellmeldungen der Gemeindebehörden das vorläufige Wahlergebnis im Wahlkreis. Er teilt unter Einbeziehung der Ergebnisse der Briefwahl (§ 75 Abs. 4) das vorläufige Wahlergebnis auf schnellstem Wege dem Landeswahlleiter mit; dabei gibt er an, welcher Bewerber als gewählt gelten kann. Der Landeswahlleiter meldet dem Bundeswahlleiter die eingehenden Wahlkreisergebnisse sofort und laufend weiter.
(4) Der Landeswahlleiter ermittelt nach den Schnellmeldungen der Kreiswahlleiter das vorläufige zahlenmäßige Wahlergebnis im Land und meldet es auf schnellstem Wege dem Bundeswahlleiter.
(5) Der Bundeswahlleiter ermittelt nach den Schnellmeldungen der Landeswahlleiter entsprechend § 78 das vorläufige Wahlergebnis im Wahlgebiet.
(6) Die Wahlleiter geben nach Durchführung der ohne Vorliegen der Wahlniederschriften möglichen Überprüfungen die vorläufigen Wahlergebnisse mündlich oder in geeigneter anderer Form bekannt.
(7) Die Schnellmeldungen der Wahlvorsteher, Gemeindebehörden und Kreiswahlleiter werden nach dem Muster der Anlage 28 erstattet. Der Landeswahlleiter kann Anordnungen zur Art und Weise der Übermittlung treffen. Er kann auch anordnen, dass die Wahlergebnisse der Wahlbezirke und der Gemeinden gleichzeitig dem Kreiswahlleiter und ihm mitzuteilen sind. Die mitgeteilten Ergebnisse darf der Landeswahlleiter erst dann bei der Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses im Land berücksichtigen, wenn die Mitteilung des Kreiswahlleiters nach Absatz 3 Satz 2 vorliegt.
§ 76 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis
(1) Der Kreiswahlleiter prüft die Wahlniederschriften der Wahlvorstände auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit. Er stellt nach den Wahlniederschriften das endgültige Ergebnis der Wahl im Wahlkreis und der Wahl nach Landeslisten wahlbezirksweise und nach Briefwahlvorständen geordnet nach dem Muster der Anlage 30 zusammen. Dabei bildet der Kreiswahlleiter für die Gemeinden und Kreise Zwischensummen, im Falle einer Anordnung nach § 8 Abs. 3 des Bundeswahlgesetzes auch für die Briefwahlergebnisse. Ergeben sich aus der Wahlniederschrift oder aus sonstigen Gründen Bedenken gegen die Ordnungsmäßigkeit des Wahlgeschäfts, so klärt sie der Kreiswahlleiter soweit wie möglich auf.
(2) Nach Berichterstattung durch den Kreiswahlleiter ermittelt der Kreiswahlausschuss das Wahlergebnis des Wahlkreises und stellt fest
- die Zahl der Wahlberechtigten,
2. die Zahl der Wähler,
3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Erststimmen,
4. die Zahlen der gültigen und ungültigen Zweitstimmen,
5. die Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Erststimmen,
6. die Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Zweitstimmen.
Der Kreiswahlausschuss ist berechtigt, Feststellungen des Wahlvorstandes zu berichtigen und dabei auch über die Gültigkeit abgegebener Stimmen abweichend zu beschließen. Ungeklärte Bedenken vermerkt er in der Niederschrift.
(3) Der Kreiswahlausschuss stellt ferner fest, welcher Bewerber im Wahlkreis gewählt ist.
(4) Ist bei der Wahl im Wahlkreis der Bewerber eines anderen Kreiswahlvorschlages (§ 20 Abs. 3 des Bundeswahlgesetzes) oder der Bewerber einer Partei, für die im Land keine Landesliste zugelassen ist, gewählt worden, so fordert der Kreiswahlleiter von allen Gemeindebehörden die für diesen Bewerber abgegebenen Stimmzettel ein und fügt ihnen die durch Briefwahl abgegebenen sowie die bei den Wahlniederschriften befindlichen, auf diesen Bewerber lautenden Stimmzettel bei. Gleiches gilt, wenn der Bewerber einer Partei gewählt worden ist, die nach dem vorläufigen Wahlergebnis im Wahlgebiet (§ 71 Absatz 5) oder nach der abschließenden Ermittlung des Stimmanteils der einzelnen Parteien im Wahlgebiet und der Zahl der von den einzelnen Parteien im Wahlgebiet errungenen Wahlkreissitze durch den Bundeswahlleiter (§ 78 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und 4) nach § 6 Absatz 3 des Bundeswahlgesetzes bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt wird. Der Kreiswahlausschuss stellt fest, wieviel Zweitstimmen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes unberücksichtigt bleiben und bei welchen Landeslisten sie abzusetzen sind.
(5) Im Anschluss an die Feststellung gibt der Kreiswahlleiter das Wahlergebnis mit den in Absatz 2 Satz 1 sowie in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Angaben mündlich bekannt.
(6) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 5 Abs. 7) ist nach dem Muster der Anlage 32 zu fertigen. Die Niederschrift und die ihr beigefügte Zusammenstellung des Wahlergebnisses nach dem Muster der Anlage 30 sind von allen Mitgliedern des Kreiswahlausschusses, die an der Verhandlung teilgenommen haben, und von dem Schriftführer zu unterzeichnen.
(7) Der Kreiswahlleiter benachrichtigt den Gewählten nach der mündlichen Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses und weist ihn auf die Vorschriften des § 45 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes, bei einer Ersatzwahl (§ 48 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes) auf die Vorschriften des § 45 Abs. 1 und 2 des Bundeswahlgesetzes hin. Bei einer Wiederholungswahl (§ 44 des Bundeswahlgesetzes) benachrichtigt er den Gewählten mittels Zustellung (§ 87 Abs. 1) und weist ihn auf die Vorschriften des § 45 Abs. 3 des Bundeswahlgesetzes hin.
(8) Der Kreiswahlleiter übersendet dem Landeswahlleiter und dem Bundeswahlleiter auf schnellstem Wege eine Ausfertigung der Niederschrift des Kreiswahlausschusses mit der dazugehörigen Zusammenstellung.
(9) Der Landeswahlleiter benachrichtigt den Bundeswahlleiter und den Präsidenten des Deutschen Bundestages sofort, wenn der gewählte Bewerber die Wahl abgelehnt hat. Bei einer Wiederholungswahl (§ 44 des Bundeswahlgesetzes) teilt zudem der Kreiswahlleiter sofort nach Ablauf der Frist des § 44 Abs. 4 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes dem Landeswahlleiter und dem Bundeswahlleiter sowie dem Präsidenten des Deutschen Bundestages mit, an welchem Tag die Annahmeerklärung des gewählten Bewerbers eingegangen ist. Im Falle des § 45 Abs. 3 Satz 3 des Bundeswahlgesetzes teilt er mit, an welchem Tag die Benachrichtigung zugestellt worden ist.
§ 77 Ermittlung und Feststellung des Zweitstimmenergebnisses im Land
(1) Der Landeswahlleiter prüft die Wahlniederschriften der Kreiswahlausschüsse und stellt danach die endgültigen Wahlergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen des Landes (§ 76 Abs. 2 und 4) nach dem Muster der Anlage 30 zum Wahlergebnis des Landes zusammen.
(2) Nach Berichterstattung durch den Landeswahlleiter ermittelt der Landeswahlausschuss das Zweitstimmenergebnis im Land und stellt fest
- die Zahl der Wahlberechtigten,
2. die Zahl der Wähler,
3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Zweitstimmen,
4. die Zahlen der für die einzelnen Landeslisten abgegebenen gültigen Zweitstimmen und
5. im Falle des § 6 Abs. 1 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes die Zahlen der für die Sitzverteilung zu berücksichtigenden Zweitstimmen der einzelnen Landeslisten (bereinigte Zahlen).
Der Landeswahlausschuss ist berechtigt, rechnerische Berichtigungen an den Feststellungen der Wahlvorstände und Kreiswahlausschüsse vorzunehmen.
(3) Im Anschluss an die Feststellung gibt der Landeswahlleiter das Wahlergebnis mit den in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Angaben mündlich bekannt.
(4) Die Niederschrift über die Sitzung (§ 5 Abs. 7) ist nach dem Muster der Anlage 33 zu fertigen. § 76 Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend.
(5) Der Landeswahlleiter übersendet dem Bundeswahlleiter eine Ausfertigung der Niederschrift mit der Feststellung des Zweitstimmenergebnisses sowie eine Zusammenstellung der Wahlergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen des Landes (Absatz 1).
§ 78 Abschließende Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Landeslistenwahl
(1) Der Bundeswahlleiter prüft die Wahlniederschriften der Landeswahlausschüsse. Er ermittelt nach den Niederschriften der Landes- und Kreiswahlausschüsse
1. die Zahlen der Zweitstimmen der Landeslisten jeder Partei,
2. die Gesamtzahl der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen,
3. den Prozentsatz des Stimmenanteils der einzelnen Parteien im Wahlgebiet an der Gesamtzahl der gültigen Zweitstimmen,
4. die Zahl der von den einzelnen Parteien im Wahlgebiet errungenen Wahlkreissitze,
5. die bereinigten Zweitstimmenzahlen der Landeslisten und jeder Partei,
6. die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerber, die nach § 6 Abs. 1 Satz 3 des Bundeswahlgesetzes von der Gesamtzahl der Abgeordneten abzuziehen sind, und
7. die Zahl der in der ersten Verteilung (§ 6 Absatz 2 Satz 1 Bundeswahlgesetz) den Ländern nach Bevölkerungsanteil (§ 3 Absatz 1 Bundeswahlgesetz) gemäß den letzten amtlichen Bevölkerungszahlen zuzuordnenden Sitze.
Ergeben sich danach gegenüber dem vorläufigen Wahlergebnis im Wahlgebiet (§ 71 Absatz 5) Änderungen für die Berücksichtigung von Parteien bei der Sitzverteilung nach § 6 Absatz 3 des Bundeswahlgesetzes, teilt der Bundeswahlleiter dies den betroffenen Kreiswahlleitern und Landeswahlleitern im Hinblick auf § 76 Absatz 4 und § 77 Absatz 2 Nummer 5 auf schnellstem Wege mit und ermittelt die Zahlen nach den geänderten Niederschriften der Kreiswahlausschüsse und Landeswahlausschüsse. Er berechnet nach Maßgabe des § 6 des Bundeswahlgesetzes die Stimmenzahlen der einzelnen Landeslisten und der Parteien sowie die Gesamtzahl der Sitze und verteilt die Sitze auf die Parteien und deren Landeslisten.
(2) Nach Berichterstattung durch den Bundeswahlleiter ermittelt der Bundeswahlausschuss das Gesamtergebnis der Landeslistenwahl und stellt für das Wahlgebiet fest
1. die Zahl der Wahlberechtigten,
2. die Zahl der Wähler,
3. die Zahlen der gültigen und ungültigen Zweitstimmen,
4. die Zahlen der auf die einzelnen Parteien entfallenen gültigen Zweitstimmen,
5. die Parteien, die nach § 6 Absatz 3 des Bundeswahlgesetzes
a) an der Verteilung der Listensitze teilnehmen,
b) bei der Verteilung der Listensitze unberücksichtigt bleiben,
6. die bereinigten Zahlen der auf die einzelnen Parteien entfallenen Zweitstimmen,
7. die Zahl der Sitze, die auf die einzelnen Parteien und Landeslisten entfallen,
8. welche Landeslistenbewerber gewählt sind.
Der Bundeswahlausschuss ist berechtigt, rechnerische Berichtigungen an den Feststellungen der Landeswahlausschüsse vorzunehmen.
(3) Im Anschluss an die Ermittlung und Feststellung gibt der Bundeswahlleiter das Wahlergebnis mit den in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7 bezeichneten Angaben mündlich bekannt. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass er die Feststellung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 8 durch Aushang im Sitzungsraum bekanntgibt.
(4) § 76 Abs. 6 findet entsprechende Anwendung.
(5) Der Bundeswahlleiter teilt den Landeswahlleitern mit, welche Landeslistenbewerber gewählt sind.
§ 81 Überprüfung der Wahl durch die Landeswahlleiter und den Bundeswahlleiter
(1) Die Landeswahlleiter und der Bundeswahlleiter prüfen, ob die Wahl nach den Vorschriften des Bundeswahlgesetzes, dieser Verordnung und der Bundeswahlgeräteverordnung vom 3. September 1975 (BGBl. I S. 2459) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt worden ist. Nach dem Ergebnis ihrer Prüfung entscheiden sie, ob Einspruch gegen die Wahl einzulegen ist (§ 2 Abs. 2 des Wahlprüfungsgesetzes).
(2) Auf Anforderung haben die Kreiswahlleiter dem Landeswahlleiter und über diesen dem Bundeswahlleiter die bei ihnen, den Gemeinden und Verwaltungsbehörden der Kreise vorhandenen Wahlunterlagen zu übersenden. Der Bundeswahlleiter kann verlangen, dass ihm die Landeswahlleiter die bei ihnen
Ausstellung und Sperrung des Ausweises; elektronischer Identitätsnachweis
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
§ 9 Ausstellung des Ausweises
(1) Personalausweise und vorläufige Personalausweise werden auf Antrag für Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ausgestellt. § 3a Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist nicht anzuwenden. Im Antragsverfahren nachzureichende Erklärungen können mittels Datenübertragung abgegeben werden. Die antragstellende Person und ihr gesetzlicher Vertreter können sich bei der Stellung des Antrags nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt nicht für eine handlungs- oder einwilligungsunfähige antragstellende Person, wenn eine für diesen Fall erteilte, öffentlich beglaubigte oder beurkundete Vollmacht vorliegt. Die antragstellende Person und ihr gesetzlicher oder bevollmächtigter Vertreter sollen persönlich erscheinen.
(2) Für Minderjährige, die noch nicht 16 Jahre alt sind, und für Personen, die geschäftsunfähig sind und sich nicht nach Absatz 1 Satz 5 durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, kann nur diejenige Person den Antrag stellen, die sorgeberechtigt ist oder als Betreuer ihren Aufenthalt bestimmen darf. Sie ist verpflichtet, für Jugendliche, die 16, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, innerhalb von sechs Wochen, nachdem der Jugendliche 16 Jahre alt geworden ist, den Antrag auf Ausstellung eines Ausweises zu stellen, falls dies der Jugendliche unterlässt. Jugendliche, die mindestens 16 Jahre alt sind, dürfen Verfahrenshandlungen nach diesem Gesetz vornehmen.
(3) In dem Antrag sind alle Tatsachen anzugeben, die zur Feststellung der Person des Antragstellers und seiner Eigenschaft als Deutscher notwendig sind. Die Angaben zum Doktorgrad und zu den Ordens- und Künstlernamen sind freiwillig. Die antragstellende Person hat die erforderlichen Nachweise zu erbringen. Fingerabdrücke von Kindern sind nicht abzunehmen, solange die Kinder noch nicht sechs Jahre alt sind.
(4) Bestehen Zweifel über die Person des Antragstellers, sind die zur Feststellung seiner Identität erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die Personalausweisbehörde kann die Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen veranlassen, wenn die Identität der antragstellenden Person auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. Ist die Identität festgestellt, so sind die im Zusammenhang mit der Feststellung angefallenen Unterlagen zu vernichten. Die Vernichtung ist zu protokollieren.
(5) Die Unterschrift durch ein Kind ist zu leisten, wenn es zum Zeitpunkt der Beantragung des Ausweises zehn Jahre oder älter ist.
(6) Für Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes werden nach Maßgabe des § 6a Ersatz-Personalausweise von Amts wegen ausgestellt. Absatz 1 Satz 2 bis 6, Absatz 2 Satz 3, Absatz 3 Satz 1 bis 3 sowie die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.
Paßgesetz (PaßG)
§ 6 Ausstellung eines Passes
(1) Der Pass wird auf Antrag ausgestellt. § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Im Antragsverfahren nachzureichende Erklärungen können im Wege der Datenübertragung abgegeben werden. Der Passbewerber und sein gesetzlicher Vertreter können sich bei der Stellung des Antrags nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt nicht für einen handlungs- oder einwilligungsunfähigen Passbewerber, wenn eine für diesen Fall erteilte, öffentlich beglaubigte oder beurkundete Vollmacht vorliegt. Für Minderjährige und für Personen, die geschäftsunfähig sind und sich nicht nach Satz 5 durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, kann nur derjenige den Antrag stellen, der als Sorgeberechtigter ihren Aufenthalt zu bestimmen hat. Der Passbewerber und sein gesetzlicher oder bevollmächtigter Vertreter sollen persönlich erscheinen. Ist der Passbewerber am persönlichen Erscheinen gehindert, kann nur ein vorläufiger Reisepass beantragt werden.
(2) In dem Antrag sind alle Tatsachen anzugeben, die zur Feststellung der Person des Passbewerbers und seiner Eigenschaft als Deutscher oder, in den Fällen des § 1 Abs. 4 Satz 2, seiner Eigenschaft als Angehöriger eines anderen Staates notwendig sind. Der Passbewerber hat die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Soweit in den Pass Fingerabdrücke aufzunehmen sind, sind diese dem Passbewerber abzunehmen und nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 elektronisch zu erfassen; der Passbewerber hat bei der Abnahme der Fingerabdrücke mitzuwirken.
(2a) Beantragt ein Passbewerber nach § 4 Abs. 1 Satz 4 die Eintragung des von seinem Geburtseintrag abweichenden Geschlechts, hat er den Beschluss des Gerichts über die Vornamensänderung nach § 1 des Transsexuellengesetzes vorzulegen. Beantragt ein Passbewerber nach § 4 Absatz 1 Satz 6 die Eintragung eines von seinem Personenstandseintrag abweichenden Geschlechts, hat er die von dem Standesbeamten beurkundete Erklärung nach § 45b des Personenstandsgesetzes vorzulegen. Eintragungen des Geschlechts im Pass, die nach den Sätzen 1 und 2 von Eintragungen im Personenstandsregister abweichen, kommt keine weitere Rechtswirkung zu.
(2b) In den Fällen des § 1 Abs. 4 Satz 2 darf die zuständige Passbehörde vor Ausstellung eines amtlichen Passes zur Feststellung von Passversagungsgründen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 oder zur Prüfung von sonstigen Sicherheitsbedenken um Auskunft aus dem Ausländerzentralregister ersuchen. Soweit dies zur Feststellung von Passversagungsgründen nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 oder zur Prüfung sonstiger Sicherheitsbedenken erforderlich ist, darf die zuständige Passbehörde in den Fällen des § 1 Abs. 4 Satz 2 die erhobenen Daten nach § 4 Abs. 1 an den Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Militärischen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt übermitteln; zusätzlich darf die Passbehörde die nach Absatz 2 Satz 3 erhobenen Daten an das Bundeskriminalamt übermitteln, das Amtshilfe bei der Auswertung der Daten leistet. Satz 2 gilt nicht für Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die nach Satz 2 ersuchten Behörden teilen der anfragenden Passbehörde unverzüglich mit, ob Passversagungsgründe nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 oder sonstige Sicherheitsbedenken vorliegen.
(3) Bestehen Zweifel über die Person des Paßbewerbers, sind die zur Feststellung seiner Identität erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die Paßbehörde kann die Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen veranlassen, wenn die Identität des Paßbewerbers auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. Ist die Identität festgestellt, so sind die im Zusammenhang mit der Feststellung angefallenen Unterlagen zu vernichten. Über die Vernichtung ist eine Niederschrift anzufertigen.
(4) Die Paßbehörde kann einen Paß von Amts wegen ausstellen, wenn dies im überwiegenden öffentlichen Interesse oder zur Abwendung wesentlicher Nachteile für den Betroffenen geboten ist.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für die Ausstellung von ausschließlich als Paßersatz bestimmten amtlichen Ausweisen, sofern in den für sie geltenden Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist.
Art. 38
(1) 1Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 2Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt.
(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.
Gegen alle Verantwortlichen und deren nicht namentlich bekannten beteiligten Mitarbeiter aller folgend aufgeführte Behörden:
|
Wahlkreis
|
Gebiet des Wahlkreises
|
|
Nr.
|
Name
|
|
Schleswig-Holstein
|
|
1
|
Flensburg – Schleswig |
Kreisfreie Stadt Flensburg |
|
|
|
Kreis Schleswig-Flensburg |
|
2
|
Nordfriesland – Dithmarschen Nord |
Kreis Nordfriesland |
|
|
|
vom Kreis Dithmarschen |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinde Heide |
|
|
|
|
Amt Büsum-Wesselburen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Büsum, Büsumer Deichhausen, Friedrichsgabekoog, Hedwigenkoog, Hellschen-Heringsand-Unterschaar, Hillgroven, Norddeich, Oesterdeichstrich, Oesterwurth, Reinsbüttel, Schülp, Strübbel, Süderdeich, Warwerort, Wesselburen, Wesselburener Deichhausen, Wesselburenerkoog, Westerdeichstrich |
|
|
|
|
Kirchspielslandgemeinde Eider |
|
|
|
|
die Gemeinden
Barkenholm, Bergewöhrden, Dellstedt, Delve, Dörpling, Fedderingen, Gaushorn, Glüsing, Groven, Hemme, Hennstedt, Hövede, Hollingstedt, Karolinenkoog, Kleve, Krempel, Lehe, Linden, Lunden, Norderheistedt, Pahlen, Rehm-Flehde-Bargen, Sankt Annen, Schalkholz, Schlichting, Süderdorf, Süderheistedt, Tellingstedt, Tielenhemme, Wallen, Welmbüttel, Westerborstel, Wiemerstedt, Wrohm |
|
|
|
|
Kirchspielslandgemeinde Heider Umland |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hemmingstedt, Lieth, Lohe-Rickelshof, Neuenkirchen, Norderwöhrden, Nordhastedt, Ostrohe, Stelle-Wittenwurth, Weddingstedt, Wesseln, Wöhrden |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 3) |
|
3
|
Steinburg – Dithmarschen Süd |
Kreis Steinburg |
|
|
|
vom Kreis Dithmarschen |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinde Brunsbüttel |
|
|
|
|
Amt Burg-St. Michaelisdonn |
|
|
|
|
die Gemeinden
Averlak, Brickeln, Buchholz, Burg (Dithmarschen), Dingen, Eddelak, Eggstedt, Frestedt, Großenrade, Hochdonn, Kuden, Quickborn, Sankt Michaelisdonn, Süderhastedt |
|
|
|
|
Amt Marne-Nordsee |
|
|
|
|
die Gemeinden
Diekhusen-Fahrstedt, Friedrichskoog, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Kronprinzenkoog, Marne, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, Trennewurth, Volsemenhusen |
|
|
|
|
Amt Mitteldithmarschen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Albersdorf, Arkebek, Bargenstedt, Barlt, Bunsoh, Busenwurth, Elpersbüttel, Epenwöhrden, Gudendorf, Immenstedt, Krumstedt, Meldorf, Nindorf, Nordermeldorf, Odderade, Offenbüttel, Osterrade, Sarzbüttel, Schafstedt, Schrum, Tensbüttel-Röst, Wennbüttel, Windbergen, Wolmersdorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 2) |
|
|
|
vom Kreis Segeberg |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinde Bad Bramstedt |
|
|
|
|
Amt Bad Bramstedt-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Armstedt, Bimöhlen, Borstel, Föhrden-Barl, Fuhlendorf, Großenaspe, Hagen, Hardebek, Hasenkrug, Heidmoor, Hitzhusen, Mönkloh, Weddelbrook, Wiemersdorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 6, 8) |
|
4
|
Rendsburg-Eckernförde |
Vom Kreis Rendsburg-Eckernförde |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Büdelsdorf, Eckernförde, Rendsburg, Wasbek |
|
|
|
|
Amt Achterwehr |
|
|
|
|
die Gemeinden
Achterwehr, Bredenbek, Felde, Krummwisch, Melsdorf, Ottendorf, Quarnbek, Westensee |
|
|
|
|
Amt Bordesholm |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bissee, Bordesholm, Brügge, Grevenkrug, Groß Buchwald, Hoffeld, Loop, Mühbrook, Negenharrie, Reesdorf, Schmalstede, Schönbek, Sören, Wattenbek |
|
|
|
|
Amt Dänischenhagen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dänischenhagen, Noer, Schwedeneck, Strande |
|
|
|
|
Amt Dänischer Wohld |
|
|
|
|
die Gemeinden
Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel, Tüttendorf |
|
|
|
|
Amt Eiderkanal |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld (Rendsburg), Osterrönfeld, Rade b. Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf |
|
|
|
|
Amt Flintbek |
|
|
|
|
die Gemeinden
Böhnhusen, Flintbek, Schönhorst, Techelsdorf |
|
|
|
|
Amt Fockbek |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alt Duvenstedt, Fockbek, Nübbel, Rickert |
|
|
|
|
Amt Hohner Harde |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bargstall, Breiholz, Christiansholm, Elsdorf-Westermühlen, Friedrichsgraben, Friedrichsholm, Hamdorf, Hohn, Königshügel, Lohe-Föhrden, Prinzenmoor, Sophienhamm |
|
|
|
|
Amt Hüttener Berge |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ahlefeld-Bistensee, Ascheffel, Borgstedt, Brekendorf, Bünsdorf, Damendorf, Groß Wittensee, Haby, Holtsee, Holzbunge, Hütten, Klein Wittensee, Neu Duvenstedt, Osterby, Owschlag, Sehestedt |
|
|
|
|
Amt Jevenstedt |
|
|
|
|
die Gemeinden
Brinjahe, Embühren, Haale, Hamweddel, Hörsten, Jevenstedt, Luhnstedt, Schülp b. Rendsburg, Stafstedt, Westerrönfeld |
|
|
|
|
Amt Mittelholstein |
|
|
|
|
die Gemeinden
Arpsdorf, Aukrug, Beldorf, Bendorf, Beringstedt, Bornholt, Ehndorf, Gokels, Grauel, Hanerau-Hademarschen, Heinkenborstel, Hohenwestedt, Jahrsdorf, Lütjenwestedt, Meezen, Mörel, Nienborstel, Nindorf, Oldenbüttel, Osterstedt, Padenstedt, Rade b. Hohenwestedt, Remmels, Seefeld, Steenfeld, Tackesdorf, Tappendorf, Thaden, Todenbüttel, Wapelfeld |
|
|
|
|
Amt Molfsee |
|
|
|
|
die Gemeinden
Blumenthal, Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek, Rumohr, Schierensee |
|
|
|
|
Amt Nortorfer Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bargstedt, Bokel, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Eisendorf, Ellerdorf, Emkendorf, Gnutz, Groß Vollstedt, Krogaspe, Langwedel, Nortorf, Oldenhütten, Schülp b. Nortorf, Timmaspe, Warder |
|
|
|
|
Amt Schlei-Ostsee |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altenhof, Barkelsby, Brodersby, Damp, Dörphof, Fleckeby, Gammelby, Goosefeld, Güby, Holzdorf, Hummelfeld, Karby, Kosel, Loose, Rieseby, Thumby, Waabs, Windeby, Winnemark |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 5) |
|
5
|
Kiel |
Kreisfreie Stadt Kiel |
|
|
|
vom Kreis Rendsburg-Eckernförde |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Altenholz, Kronshagen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 4) |
|
6
|
Plön – Neumünster |
Kreisfreie Stadt Neumünster |
|
|
|
Kreis Plön |
|
|
|
vom Kreis Segeberg |
|
|
|
|
Amt Boostedt-Rickling |
|
|
|
|
die Gemeinden
Boostedt, Daldorf, Groß Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf, Rickling |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 3, 8) |
|
7
|
Pinneberg |
Kreis Pinneberg |
|
8
|
Segeberg – Stormarn-Mitte |
Vom Kreis Segeberg |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Bad Segeberg, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt, Wahlstedt |
|
|
|
|
Amt Bornhöved |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bornhöved, Damsdorf, Gönnebek, Schmalensee, Stocksee, Tarbek, Tensfeld, Trappenkamp |
|
|
|
|
Amt Itzstedt |
|
|
|
|
die Gemeinden
Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth, Sülfeld, (ohne Tangstedt, s. Kreis Stormarn) |
|
|
|
|
Amt Kaltenkirchen-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentföhrden, Nützen, Schmalfeld |
|
|
|
|
Amt Kisdorf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf, Oersdorf, Sievershütten, Struvenhütten, Stuvenborn, Wakendorf II, Winsen |
|
|
|
|
Amt Leezen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bark, Bebensee, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Todesfelde, Wittenborn |
|
|
|
|
Amt Trave-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, Geschendorf, Glasau, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Krems II, Negernbötel, Nehms, Neuengörs, Pronstorf, Rohlstorf, Schackendorf, Schieren, Seedorf, Stipsdorf, Strukdorf, Travenhorst, Traventhal, Wakendorf I, Weede, Wensin, Westerrade |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 3, 6) |
|
|
|
vom Kreis Stormarn |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Ammersbek, Bad Oldesloe, Bargteheide |
|
|
|
|
Amt Bad Oldesloe-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Grabau, Lasbek, Meddewade, Neritz, Pölitz, Rethwisch, Rümpel, Steinburg, Travenbrück |
|
|
|
|
Amt Bargteheide-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bargfeld-Stegen, Delingsdorf, Elmenhorst, Hammoor, Jersbek, Nienwohld, Todendorf, Tremsbüttel |
|
|
|
|
Gemeinde Tangstedt (Amt Itzstedt, Krs. Segeberg) |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 9, 10) |
|
9
|
Ostholstein – Stormarn-Nord |
Kreis Ostholstein |
|
|
|
vom Kreis Stormarn |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinde Reinfeld (Holstein) |
|
|
|
|
Amt Nordstormarn |
|
|
|
|
die Gemeinden
Badendorf, Barnitz, Feldhorst, Hamberge, Heidekamp, Heilshoop, Klein Wesenberg, Mönkhagen, Rehhorst, Wesenberg, Westerau, Zarpen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 8, 10) |
|
10
|
Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd |
Vom Kreis Herzogtum Lauenburg |
| |
amtsfreie Gemeinden
Geesthacht, Lauenburg/Elbe, Mölln, Ratzeburg, Schwarzenbek, Wentorf bei Hamburg |
|
|
|
|
Amt Breitenfelde |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alt-Mölln, Bälau, Borstorf, Breitenfelde, Grambek, Hornbek, Lehmrade, Niendorf/Stecknitz, Schretstaken, Talkau, Woltersdorf |
|
|
|
|
Amt Büchen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Besenthal, Bröthen, Büchen, Fitzen, Göttin, Gudow, Güster, Klein Pampau, Langenlehsten, Müssen, Roseburg, Schulendorf, Siebeneichen, Tramm, Witzeeze |
|
|
|
|
Amt Hohe Elbgeest |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aumühle, Börnsen, Dassendorf, Escheburg, Hamwarde, Hohenhorn, Kröppelshagen-Fahrendorf, Wiershop, Wohltorf, Worth |
|
|
|
|
Amt Lauenburgische Seen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Albsfelde, Bäk, Brunsmark, Buchholz, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Groß Disnack, Groß Grönau, Groß Sarau, Harmsdorf, Hollenbek, Horst, Kittlitz, Klein Zecher, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Salem, Schmilau, Seedorf, Sterley, Ziethen |
|
|
|
|
Amt Lütau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Basedow, Buchhorst, Dalldorf, Juliusburg, Krüzen, Krukow, Lanze, Lütau, Schnakenbek, Wangelau |
|
|
|
|
Amt Schwarzenbek-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Basthorst, Brunstorf, Dahmker, Elmenhorst, Fuhlenhagen, Grabau, Groß Pampau, Grove, Gülzow, Hamfelde, Havekost, Kankelau, Kasseburg, Köthel, Kollow, Kuddewörde, Möhnsen, Mühlenrade, Sahms |
|
|
|
|
vom Amt Sandesneben-Nusse |
|
|
|
|
die Gemeinden
Duvensee, Koberg, Kühsen, Lankau, Nusse, Panten, Poggensee, Ritzerau, Walksfelde |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 11) |
|
|
|
vom Kreis Stormarn |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Ahrensburg, Barsbüttel, Glinde, Großhansdorf, Oststeinbek, Reinbek |
|
|
|
|
Amt Siek |
|
|
|
|
die Gemeinden
Braak, Brunsbek, Hoisdorf, Siek, Stapelfeld |
|
|
|
|
Amt Trittau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Grande, Grönwohld, Großensee, Hamfelde, Hohenfelde, Köthel, Lütjensee, Rausdorf, Trittau, Witzhave |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 8, 9) |
|
11
|
Lübeck |
Kreisfreie Stadt Lübeck |
|
|
|
vom Kreis Herzogtum Lauenburg |
|
|
|
|
Amt Berkenthin |
|
|
|
|
die Gemeinden
Behlendorf, Berkenthin, Bliestorf, Düchelsdorf, Göldenitz, Kastorf, Klempau, Krummesse, Niendorf bei Berkenthin, Rondeshagen, Sierksrade |
|
|
|
|
vom Amt Sandesneben-Nusse |
|
|
|
|
die Gemeinden
Grinau, Groß Boden, Groß Schenkenberg, Klinkrade, Labenz, Linau, Lüchow, Sandesneben, Schiphorst, Schönberg, Schürensöhlen, Siebenbäumen, Sirksfelde, Steinhorst, Stubben, Wentorf (Amt Sandesneben) |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 10) |
|
Mecklenburg-Vorpommern
|
|
12
|
Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I |
Kreisfreie Stadt Schwerin |
|
|
vom Landkreis Ludwigslust-Parchim |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Boizenburg/Elbe, Hagenow, Ludwigslust, Lübtheen |
|
|
|
|
Amt Boizenburg-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bengerstorf, Besitz, Brahlstorf, Dersenow, Gresse, Greven, Neu Gülze, Nostorf, Schwanheide, Teldau, Tessin b. Boizenburg |
|
|
|
|
Amt Dömitz-Malliß |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dömitz, Grebs-Niendorf, Karenz, Malk Göhren, Malliß, Neu Kaliß, Vielank |
|
|
|
|
Amt Grabow |
|
|
|
|
die Gemeinden
Balow, Brunow, Dambeck, Eldena, Gorlosen, Grabow, Karstädt, Kremmin, Milow, Möllenbeck, Muchow, Prislich, Zierzow |
|
|
|
|
Amt Hagenow-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alt Zachun, Bandenitz, Belsch, Bobzin, Bresegard bei Picher, Gammelin, Groß Krams, Hoort, Hülseburg, Kirch Jesar, Kuhstorf, Moraas, Pätow-Steegen, Picher, Pritzier, Redefin, Strohkirchen, Toddin, Warlitz |
|
|
|
|
Amt Ludwigslust-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alt Krenzlin, Bresegard bei Eldena, Göhlen, Groß Laasch, Lübesse, Lüblow, Rastow, Sülstorf, Uelitz, Warlow, Wöbbelin |
|
|
|
|
Amt Neustadt-Glewe |
|
|
|
|
die Gemeinden
Blievenstorf, Brenz, Neustadt-Glewe |
|
|
|
|
Amt Stralendorf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dümmer, Holthusen, Klein Rogahn, Pampow, Schossin, Stralendorf, Warsow, Wittenförden, Zülow |
|
|
|
|
Amt Wittenburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Wittenburg, Wittendörp |
|
|
|
|
Amt Zarrentin |
|
|
|
|
die Gemeinden
Gallin, Kogel, Lüttow-Valluhn, Vellahn, Zarrentin am Schaalsee |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 13) |
|
|
|
vom Landkreis Nordwestmecklenburg |
|
|
|
|
Amt Gadebusch |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dragun, Gadebusch, Kneese, Krembz, Mühlen Eichsen, Rögnitz, Roggendorf, Veelböken |
|
|
|
|
Amt Lützow-Lübstorf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alt Meteln, Brüsewitz, Cramonshagen, Dalberg-Wendelstorf, Gottesgabe, Grambow, Klein Trebbow, Lübstorf, Lützow, Perlin, Pingelshagen, Pokrent, Schildetal, Seehof, Zickhusen |
|
|
|
|
Amt Rehna |
|
|
|
|
die Gemeinden
Carlow, Dechow, Groß Molzahn, Holdorf, Königsfeld, Rehna, Rieps, Schlagsdorf, Thandorf, Utecht, Wedendorfersee |
|
|
|
|
Amt Schönberger Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dassow, Grieben, Lüdersdorf, Menzendorf, Roduchelstorf, Schönberg, Selmsdorf, Siemz-Niendorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 13) |
|
13
|
Ludwigslust-Parchim II –
Nordwestmecklenburg II –
Landkreis Rostock I |
Vom Landkreis Ludwigslust-Parchim |
|
|
|
amtsfreie Gemeinde Parchim |
|
|
|
Amt Crivitz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Banzkow, Barnin, Bülow, Cambs, Crivitz, Demen, Dobin am See, Friedrichsruhe, Gneven, Langen Brütz, Leezen, Pinnow, Plate, Raben Steinfeld, Sukow, Tramm, Zapel |
|
|
|
|
Amt Eldenburg Lübz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Gallin-Kuppentin, Gehlsbach, Granzin, Kreien, Kritzow, Lübz, Passow, Ruhner Berge, Siggelkow, Werder |
|
|
|
|
Amt Goldberg-Mildenitz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dobbertin, Goldberg, Mestlin, Neu Poserin, Techentin |
|
|
|
|
Amt Parchimer Umland |
|
|
|
|
die Gemeinden
Domsühl, Groß Godems, Karrenzin, Lewitzrand, Obere Warnow, Rom, Spornitz, Stolpe, Ziegendorf, Zölkow |
|
|
|
|
Amt Plau am See |
|
|
|
|
die Gemeinden
Barkhagen, Ganzlin, Plau am See |
|
|
|
|
Amt Sternberger Seenlandschaft |
|
|
|
|
die Gemeinden
Blankenberg, Borkow, Brüel, Dabel, Hohen Pritz, Kloster Tempzin, Kobrow, Kuhlen-Wendorf, Mustin, Sternberg, Weitendorf, Witzin |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 12) |
|
|
|
vom Landkreis Nordwestmecklenburg |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Grevesmühlen, Insel Poel, Wismar |
|
|
|
|
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Kleinen, Barnekow, Bobitz, Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, Lübow, Metelsdorf, Ventschow |
|
|
|
|
Amt Grevesmühlen-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bernstorf, Gägelow, Roggenstorf, Rüting, Stepenitztal, Testorf-Steinfort, Upahl, Warnow |
|
|
|
|
Amt Klützer Winkel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Boltenhagen, Damshagen, Hohenkirchen, Kalkhorst, Klütz, Zierow |
|
|
|
|
Amt Neuburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Benz, Blowatz, Boiensdorf, Hornstorf, Krusenhagen, Neuburg |
|
|
|
|
Amt Neukloster-Warin |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bibow, Glasin, Jesendorf, Lübberstorf, Neukloster, Passee, Warin, Züsow, Zurow |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 12) |
|
|
|
vom Landkreis Rostock |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungsborn, Neubukow, Satow |
|
|
|
|
Amt Bad Doberan-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Admannshagen-Bargeshagen, Bartenshagen-Parkentin, Börgerende-Rethwisch, Hohenfelde, Nienhagen, Reddelich, Retschow, Steffenshagen, Wittenbeck |
|
|
|
|
Amt Neubukow-Salzhaff |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alt Bukow, Am Salzhaff, Bastorf, Biendorf, Carinerland, Rerik |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 14, 17) |
|
14
|
Rostock – Landkreis Rostock II |
Kreisfreie Stadt Rostock |
|
|
|
vom Landkreis Rostock |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Dummerstorf, Graal-Müritz, Sanitz |
|
|
|
|
Amt Carbäk |
|
|
|
|
die Gemeinden
Broderstorf, Poppendorf, Roggentin, Thulendorf |
|
|
|
|
Amt Rostocker Heide |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bentwisch, Blankenhagen, Gelbensande, Mönchhagen, Rövershagen |
|
|
|
|
Amt Schwaan |
|
|
|
|
die Gemeinden
Benitz, Bröbberow, Kassow, Rukieten, Schwaan, Vorbeck, Wiendorf |
|
|
|
|
Amt Tessin |
|
|
|
|
die Gemeinden
Cammin, Gnewitz, Grammow, Nustrow, Selpin, Stubbendorf, Tessin, Thelkow, Zarnewanz |
|
|
|
|
Amt Warnow-West |
|
|
|
|
die Gemeinden
Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, Lambrechtshagen, Papendorf, Pölchow, Stäbelow, Ziesendorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 13, 17) |
|
15
|
Vorpommern-Rügen –
Vorpommern-Greifswald I |
Landkreis Vorpommern-Rügen |
|
|
vom Landkreis Vorpommern-Greifswald |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinde Greifswald |
|
|
|
|
Amt Landhagen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Behrenhoff, Dargelin, Dersekow, Hinrichshagen, Levenhagen, Mesekenhagen, Neuenkirchen, Wackerow, Weitenhagen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 16) |
|
16
|
Mecklenburgische Seenplatte I –
Vorpommern-Greifswald II |
Vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Feldberger Seenlandschaft, Neubrandenburg |
|
|
|
|
Amt Friedland |
|
|
|
|
die Gemeinden
Datzetal, Friedland, Galenbeck |
|
|
|
|
Amt Neverin |
|
|
|
|
die Gemeinden
Beseritz, Blankenhof, Brunn, Neddemin, Neuenkirchen, Neverin, Sponholz, Staven, Trollenhagen, Woggersin, Wulkenzin, Zirzow |
|
|
|
|
Amt Stargarder Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Burg Stargard, Cölpin, Groß Nemerow, Holldorf, Lindetal, Pragsdorf |
|
|
|
|
Amt Woldegk |
|
|
|
|
die Gemeinden
Groß Miltzow, Kublank, Neetzka, Schönbeck, Schönhausen, Voigtsdorf, Woldegk |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 17) |
|
|
|
vom Landkreis Vorpommern-Greifswald |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Anklam, Heringsdorf, Pasewalk, Strasburg (Uckermark), Ueckermünde |
|
|
|
|
Amt Am Peenestrom |
|
|
|
|
die Gemeinden
Buggenhagen, Krummin, Lassan, Lütow, Sauzin, Wolgast, Zemitz |
|
|
|
|
Amt Am Stettiner Haff |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ahlbeck, Altwarp, Eggesin, Grambin, Hintersee, Leopoldshagen, Liepgarten, Luckow, Lübs, Meiersberg, Mönkebude, Vogelsang-Warsin |
|
|
|
|
Amt Anklam-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bargischow, Blesewitz, Boldekow, Bugewitz, Butzow, Ducherow, Iven, Krien, Krusenfelde, Medow, Neetzow-Liepen, Neu Kosenow, Neuenkirchen, Postlow, Rossin, Sarnow, Spantekow, Stolpe an der Peene |
|
|
|
|
Amt Jarmen-Tutow |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alt Tellin, Bentzin, Daberkow, Jarmen, Kruckow, Tutow, Völschow |
|
|
|
|
Amt Lubmin |
|
|
|
|
die Gemeinden
Brünzow, Hanshagen, Katzow, Kemnitz, Kröslin, Loissin, Lubmin, Neu Boltenhagen, Rubenow, Wusterhusen |
|
|
|
|
Amt Löcknitz-Penkun |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bergholz, Blankensee, Boock, Glasow, Grambow, Krackow, Löcknitz, Nadrensee, Penkun, Plöwen, Ramin, Rossow, Rothenklempenow |
|
|
|
|
Amt Peenetal/Loitz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Görmin, Loitz, Sassen-Trantow |
|
|
|
|
Amt Torgelow-Ferdinandshof |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altwigshagen, Ferdinandshof, Hammer a. d. Uecker, Heinrichswalde, Rothemühl, Torgelow, Wilhelmsburg |
|
|
|
|
Amt Uecker-Randow-Tal |
|
|
|
|
die Gemeinden
Brietzig, Fahrenwalde, Groß Luckow, Jatznick, Koblentz, Krugsdorf, Nieden, Papendorf, Polzow, Rollwitz, Schönwalde, Viereck, Zerrenthin |
|
|
|
|
Amt Usedom-Nord |
|
|
|
|
die Gemeinden
Karlshagen, Mölschow, Peenemünde, Trassenheide, Zinnowitz |
|
|
|
|
Amt Usedom-Süd |
|
|
|
|
die Gemeinden
Benz, Dargen, Garz, Kamminke, Korswandt, Koserow, Loddin, Mellenthin, Pudagla, Rankwitz, Stolpe auf Usedom, Ückeritz, Usedom, Zempin, Zirchow |
|
|
|
|
Amt Züssow |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bandelin, Gribow, Groß Kiesow, Groß Polzin, Gützkow, Karlsburg, Klein Bünzow, Murchin, Rubkow, Schmatzin, Wrangelsburg, Ziethen, Züssow |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 15) |
|
17
|
Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III |
Vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Dargun, Demmin, Neustrelitz, Waren (Müritz) |
|
|
|
|
Amt Demmin-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Beggerow, Borrentin, Hohenbollentin, Hohenmocker, Kentzlin, Kletzin, Lindenberg, Meesiger, Nossendorf, Sarow, Schönfeld, Siedenbrünzow, Sommersdorf, Utzedel, Verchen, Warrenzin |
|
|
|
|
Amt Malchin am Kummerower See |
|
|
|
|
die Gemeinden
Basedow, Faulenrost, Gielow, Kummerow, Malchin, Neukalen |
|
|
|
|
Amt Malchow |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alt Schwerin, Fünfseen, Göhren-Lebbin, Malchow, Nossentiner Hütte, Penkow, Silz, Walow, Zislow |
|
|
|
|
Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte |
|
|
|
|
die Gemeinden
Mirow, Priepert, Wesenberg, Wustrow |
|
|
|
|
Amt Neustrelitz-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Blankensee, Blumenholz, Carpin, Godendorf, Grünow, Hohenzieritz, Klein Vielen, Kratzeburg, Möllenbeck, Userin, Wokuhl-Dabelow |
|
|
|
|
Amt Penzliner Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ankershagen, Kuckssee, Möllenhagen, Penzlin |
|
|
|
|
Amt Röbel-Müritz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altenhof, Bollewick, Buchholz, Bütow, Eldetal, Fincken, Gotthun, Groß Kelle, Kieve, Lärz, Leizen, Melz, Priborn, Rechlin, Röbel/Müritz, Schwarz, Sietow, Stuer, Südmüritz |
|
|
|
|
Amt Seenlandschaft Waren |
|
|
|
|
die Gemeinden
Grabowhöfe, Groß Plasten, Hohen Wangelin, Jabel, Kargow, Klink, Klocksin, Moltzow, Peenehagen, Schloen-Dratow, Torgelow am See, Vollrathsruhe |
|
|
|
|
Amt Stavenhagen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bredenfelde, Briggow, Grammentin, Gülzow, Ivenack, Jürgenstorf, Kittendorf, Knorrendorf, Mölln, Ritzerow, Rosenow, Stavenhagen, Zettemin |
|
|
|
|
Amt Treptower Tollensewinkel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altenhagen, Altentreptow, Bartow, Breesen, Breest, Burow, Gnevkow, Golchen, Grapzow, Grischow, Groß Teetzleben, Gültz, Kriesow, Pripsleben, Röckwitz, Siedenbollentin, Tützpatz, Werder, Wildberg, Wolde |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 16) |
|
|
|
vom Landkreis Rostock |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Güstrow, Teterow |
|
|
|
|
Amt Bützow-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Baumgarten, Bernitt, Bützow, Dreetz, Jürgenshagen, Klein Belitz, Penzin, Rühn, Steinhagen, Tarnow, Warnow, Zepelin |
|
|
|
|
Amt Gnoien |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altkalen, Behren-Lübchin, Finkenthal, Gnoien, Walkendorf |
|
|
|
|
Amt Güstrow-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Glasewitz, Groß Schwiesow, Gülzow-Prüzen, Gutow, Klein Upahl, Kuhs, Lohmen, Lüssow, Mistorf, Mühl Rosin, Plaaz, Reimershagen, Sarmstorf, Zehna |
|
|
|
|
Amt Krakow am See |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dobbin-Linstow, Hoppenrade, Krakow am See, Kuchelmiß, Lalendorf |
|
|
|
|
Amt Laage |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dolgen am See, Hohen Sprenz, Laage, Wardow |
|
|
|
|
Amt Mecklenburgische Schweiz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alt Sührkow, Dahmen, Dalkendorf, Groß Roge, Groß Wokern, Groß Wüstenfelde, Hohen Demzin, Jördenstorf, Lelkendorf, Prebberede, Schorssow, Schwasdorf, Sukow-Levitzow, Thürkow, Warnkenhagen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 13, 14) |
|
Hamburg
|
|
18
|
Hamburg-Mitte |
Vom Bezirk Hamburg-Mitte |
|
|
|
|
die Stadtteile
Billbrook, Billstedt, Borgfelde, Finkenwerder, HafenCity, Hamburg-Altstadt, Hammerbrook, Hamm, Horn, Insel Neuwerk, Kleiner Grasbrook, Neustadt, Rothenburgsort, St. Georg, St. Pauli, Steinwerder, Veddel, Waltershof |
|
|
|
(Übriger Bezirk s. Wkr. 23) |
|
|
|
vom Bezirk Hamburg-Nord |
|
|
|
|
die Stadtteile
Barmbek-Nord, Barmbek-Süd, Dulsberg, Hohenfelde, Uhlenhorst |
|
|
|
(Übriger Bezirk s. Wkr. 21) |
|
19
|
Hamburg-Altona |
Bezirk Altona |
|
20
|
Hamburg-Eimsbüttel |
Bezirk Eimsbüttel |
|
21
|
Hamburg-Nord |
Vom Bezirk Hamburg-Nord |
|
|
|
|
die Stadtteile
Alsterdorf, Eppendorf, Fuhlsbüttel, Groß Borstel, Hoheluft-Ost, Langenhorn, Ohlsdorf, Winterhude |
|
|
|
(Übriger Bezirk s. Wkr. 18) |
|
|
|
vom Bezirk Wandsbek |
|
|
|
|
die Stadtteile
Bergstedt, Duvenstedt, Hummelsbüttel, Lemsahl-Mellingstedt, Poppenbüttel, Sasel, Wellingsbüttel, Wohldorf-Ohlstedt |
|
|
|
(Übriger Bezirk s. Wkr. 22) |
|
22
|
Hamburg-Wandsbek |
Vom Bezirk Wandsbek |
|
|
|
|
die Stadtteile
Bramfeld, Eilbek, Farmsen-Berne, Jenfeld, Marienthal, Rahlstedt, Steilshoop, Tonndorf, Volksdorf, Wandsbek |
|
|
|
(Übriger Bezirk s. Wkr. 21) |
|
23
|
Hamburg-Bergedorf – Harburg |
Bezirk Bergedorf |
|
|
|
Bezirk Harburg |
|
|
|
vom Bezirk Hamburg-Mitte |
|
|
|
|
der Stadtteil Wilhelmsburg |
|
|
|
(Übriger Bezirk s. Wkr. 18) |
|
Niedersachsen
|
|
24
|
Aurich – Emden |
Kreisfreie Stadt Emden |
|
|
|
Landkreis Aurich |
|
25
|
Unterems |
Landkreis Leer |
|
|
|
vom Landkreis Emsland |
|
|
|
|
die Gemeinden
Stadt Haren (Ems), Stadt Papenburg, Rhede (Ems), Twist |
|
|
|
|
Samtgemeinde Dörpen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dersum, Dörpen, Heede, Kluse, Lehe, Neubörger, Neulehe, Walchum, Wippingen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Lathen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Fresenburg, Lathen, Niederlangen, Oberlangen, Renkenberge, Sustrum |
|
|
|
|
Samtgemeinde Nordhümmling |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Surwold |
|
|
|
|
Samtgemeinde Sögel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Börger, Groß Berßen, Hüven, Klein Berßen, Sögel, Spahnharrenstätte, Stavern, Werpeloh |
|
|
|
|
Samtgemeinde Werlte |
|
|
|
|
die Gemeinden
Lahn, Lorup, Rastdorf, Vrees, Stadt Werlte |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 31) |
|
26
|
Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund |
Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven |
|
|
|
Landkreis Friesland |
|
|
|
Landkreis Wittmund |
|
27
|
Oldenburg – Ammerland |
Kreisfreie Stadt Oldenburg (Oldenburg) |
|
|
|
Landkreis Ammerland |
|
28
|
Delmenhorst – Wesermarsch –
Oldenburg-Land |
Kreisfreie Stadt Delmenhorst |
|
|
Landkreis Oldenburg |
|
|
|
Landkreis Wesermarsch |
|
29
|
Cuxhaven – Stade II |
Landkreis Cuxhaven |
|
|
|
vom Landkreis Stade |
|
|
|
|
die Gemeinde Drochtersen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Nordkehdingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Balje, Flecken Freiburg (Elbe), Krummendeich, Oederquart, Wischhafen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten |
|
|
|
|
die Gemeinden
Burweg, Düdenbüttel, Engelschoff, Estorf, Großenwörden, Hammah, Heinbockel, Himmelpforten, Kranenburg, Oldendorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 30) |
|
30
|
Stade I – Rotenburg II |
Vom Landkreis Rotenburg (Wümme) |
|
|
|
|
die Gemeinden
Stadt Bremervörde, Gnarrenburg |
|
|
|
|
Samtgemeinde Geestequelle |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alfstedt, Basdahl, Ebersdorf, Hipstedt, Oerel |
|
|
|
|
Samtgemeinde Selsingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Anderlingen, Deinstedt, Farven, Ostereistedt, Rhade, Sandbostel, Seedorf, Selsingen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Sittensen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Groß Meckelsen, Hamersen, Kalbe, Klein Meckelsen, Lengenbostel, Sittensen, Tiste, Vierden, Wohnste |
|
|
|
|
Samtgemeinde Tarmstedt |
|
|
|
|
die Gemeinden
Breddorf, Bülstedt, Hepstedt, Kirchtimke, Tarmstedt, Vorwerk, Westertimke, Wilstedt |
|
|
|
|
Samtgemeinde Zeven |
|
|
|
|
die Gemeinden
Elsdorf, Gyhum, Heeslingen, Stadt Zeven |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 35) |
|
|
|
vom Landkreis Stade |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hansestadt Buxtehude, Jork, Hansestadt Stade |
|
|
|
|
Samtgemeinde Apensen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Apensen, Beckdorf, Sauensiek |
|
|
|
|
Samtgemeinde Fredenbeck |
|
|
|
|
die Gemeinden
Deinste, Fredenbeck, Kutenholz |
|
|
|
|
Samtgemeinde Harsefeld |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ahlerstedt, Bargstedt, Brest, Flecken Harsefeld |
|
|
|
|
Samtgemeinde Horneburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Agathenburg, Bliedersdorf, Dollern, Flecken Horneburg, Nottensdorf |
|
|
|
|
Samtgemeinde Lühe |
|
|
|
|
die Gemeinden
Grünendeich, Guderhandviertel, Hollern-Twielenfleth, Mittelnkirchen, Neuenkirchen, Steinkirchen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 29) |
|
31
|
Mittelems |
Landkreis Grafschaft Bentheim |
|
|
|
vom Landkreis Emsland |
|
|
|
|
die Gemeinden
Emsbüren, Geeste, Stadt Haselünne, Stadt Lingen (Ems), Stadt Meppen, Salzbergen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Freren |
|
|
|
|
die Gemeinden
Andervenne, Beesten, Stadt Freren, Messingen, Thuine |
|
|
|
|
Samtgemeinde Herzlake |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dohren, Herzlake, Lähden |
|
|
|
|
Samtgemeinde Lengerich |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bawinkel, Gersten, Handrup, Langen, Lengerich, Wettrup |
|
|
|
|
Samtgemeinde Spelle |
|
|
|
|
die Gemeinden
Lünne, Schapen, Spelle |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 25) |
|
32
|
Cloppenburg – Vechta |
Landkreis Cloppenburg |
|
|
|
Landkreis Vechta |
|
33
|
Diepholz – Nienburg I |
Landkreis Diepholz |
|
|
|
vom Landkreis Nienburg (Weser) |
|
|
|
|
Samtgemeinde Grafschaft Hoya |
|
|
|
|
die Gemeinden
Flecken Bücken, Eystrup, Gandesbergen, Hämelhausen, Hassel (Weser), Hilgermissen, Stadt Hoya, Hoyerhagen, Schweringen, Warpe |
|
|
|
|
Samtgemeinde Uchte |
|
|
|
|
die Gemeinden
Flecken Diepenau, Raddestorf, Flecken Uchte, Warmsen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 40) |
|
34
|
Osterholz – Verden |
Landkreis Osterholz |
|
|
|
Landkreis Verden |
|
35
|
Rotenburg I – Heidekreis |
Landkreis Heidekreis |
|
|
|
vom Landkreis Rotenburg (Wümme) |
|
|
|
|
die Gemeinden
Stadt Rotenburg (Wümme), Scheeßel, Stadt Visselhövede |
|
|
|
|
Samtgemeinde Bothel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bothel, Brockel, Hemsbünde, Hemslingen, Kirchwalsede, Westerwalsede |
|
|
|
|
Samtgemeinde Fintel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen, Vahlde |
|
|
|
|
Samtgemeinde Sottrum |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ahausen, Bötersen, Hassendorf, Hellwege, Horstedt, Reeßum, Sottrum |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 30) |
|
36
|
Harburg |
Landkreis Harburg |
|
37
|
Lüchow-Dannenberg – Lüneburg |
Landkreis Lüchow-Dannenberg |
|
|
|
Landkreis Lüneburg |
|
38
|
Osnabrück-Land |
Vom Landkreis Osnabrück |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Essen, Stadt Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Bissendorf, Bohmte, Stadt Bramsche, Stadt Dissen am Teutoburger Wald, Glandorf, Hilter am Teutoburger Wald, Stadt Melle, Ostercappeln |
|
|
|
|
Samtgemeinde Artland |
|
|
|
|
die Gemeinden
Badbergen, Menslage, Nortrup, Stadt Quakenbrück |
|
|
|
|
Samtgemeinde Bersenbrück |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alfhausen, Ankum, Stadt Bersenbrück, Eggermühlen, Gehrde, Kettenkamp, Rieste |
|
|
|
|
Samtgemeinde Fürstenau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Berge, Bippen, Stadt Fürstenau |
|
|
|
|
Samtgemeinde Neuenkirchen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Merzen, Neuenkirchen, Voltlage |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 39) |
|
39
|
Stadt Osnabrück |
Kreisfreie Stadt Osnabrück |
|
|
|
vom Landkreis Osnabrück |
|
|
|
|
die Gemeinden
Belm, Stadt Georgsmarienhütte, Hagen am Teutoburger Wald, Hasbergen, Wallenhorst |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 38) |
|
40
|
Nienburg II – Schaumburg |
Landkreis Schaumburg |
|
|
|
vom Landkreis Nienburg (Weser) |
|
|
|
|
die Gemeinden
Stadt Nienburg (Weser), Stadt Rehburg-Loccum, Flecken Steyerberg |
|
|
|
|
Samtgemeinde Heemsen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Flecken Drakenburg, Haßbergen, Heemsen, Rohrsen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Liebenau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Binnen, Flecken Liebenau, Pennigsehl |
|
|
|
|
Samtgemeinde Marklohe |
|
|
|
|
die Gemeinden
Balge, Marklohe, Wietzen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Mittelweser |
|
|
|
|
die Gemeinden
Estorf, Husum, Landesbergen, Leese, Stolzenau |
|
|
|
|
Samtgemeinde Steimbke |
|
|
|
|
die Gemeinden
Linsburg, Rodewald, Steimbke, Stöckse |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 33) |
|
41
|
Stadt Hannover I |
„Hannover-Nord“, nördlicher Teil der Stadt Hannover, mit den Stadtteilen |
|
|
|
|
Anderten, Bothfeld, Brink-Hafen, Burg, Groß-Buchholz, Hainholz, Heideviertel, Isernhagen-Süd, Kleefeld, Lahe, Ledeburg, Leinhausen, List, Marienwerder, Misburg-Nord, Misburg-Süd, Nordhafen, Oststadt, Sahlkamp, Stöcken, Vahrenheide, Vahrenwald, Vinnhorst, Zoo |
|
|
|
(Übrige Stadtteile s. Wkr. 42) |
|
42
|
Stadt Hannover II |
„Hannover-Süd“, südlicher Teil der Stadt Hannover, mit den Stadtteilen |
|
|
|
|
Ahlem, Badenstedt, Bemerode, Bornum, Bult, Calenberger Neustadt, Davenstedt, Döhren, Herrenhausen, Kirchrode, Limmer, Linden-Mitte, Linden-Nord, Linden-Süd, Mitte, Mittelfeld, Mühlenberg, Nordstadt, Oberricklingen, Ricklingen, Seelhorst, Südstadt, Waldhausen, Waldheim, Wettbergen, Wülfel, Wülferode |
|
|
|
(Übrige Stadtteile s. Wkr. 41) |
|
43
|
Hannover-Land I |
Von der Region Hannover |
|
|
|
|
die Gemeinden
Stadt Burgdorf, Stadt Burgwedel, Stadt Garbsen, Isernhagen, Stadt Langenhagen, Stadt Neustadt am Rübenberge, Wedemark, Stadt Wunstorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 41, 42, 47) |
|
44
|
Celle – Uelzen |
Landkreis Celle |
|
|
|
Landkreis Uelzen |
|
45
|
Gifhorn – Peine |
Landkreis Peine |
|
|
|
vom Landkreis Gifhorn |
|
|
|
|
die Gemeinden
Stadt Gifhorn, Sassenburg, Stadt Wittingen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Hankensbüttel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dedelstorf, Hankensbüttel, Obernholz, Sprakensehl, Steinhorst |
|
|
|
|
Samtgemeinde Isenbüttel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Calberlah, Isenbüttel, Ribbesbüttel, Wasbüttel |
|
|
|
|
Samtgemeinde Meinersen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hillerse, Leiferde, Meinersen, Müden (Aller) |
|
|
|
|
Samtgemeinde Papenteich |
|
|
|
|
die Gemeinden
Adenbüttel, Didderse, Meine, Rötgesbüttel, Schwülper, Vordorf |
|
|
|
|
Samtgemeinde Wesendorf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Groß Oesingen, Schönewörde, Ummern, Wagenhoff, Wahrenholz, Wesendorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 51) |
|
46
|
Hameln-Pyrmont – Holzminden |
Landkreis Hameln-Pyrmont |
|
|
|
Landkreis Holzminden |
|
|
|
vom Landkreis Northeim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Flecken Bodenfelde, Stadt Uslar und das gemeindefreie Gebiet Solling |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 52) |
|
47
|
Hannover-Land II |
Von der Region Hannover |
|
|
|
|
die Gemeinden
Stadt Barsinghausen, Stadt Gehrden, Stadt Hemmingen, Stadt Laatzen, Stadt Lehrte, Stadt Pattensen, Stadt Ronnenberg, Stadt Seelze, Stadt Sehnde, Stadt Springe, Uetze, Wennigsen (Deister) |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 41, 42, 43) |
|
48
|
Hildesheim |
Landkreis Hildesheim |
|
49
|
Salzgitter – Wolfenbüttel |
Kreisfreie Stadt Salzgitter |
|
|
|
Landkreis Wolfenbüttel |
|
|
|
vom Landkreis Goslar |
|
|
|
|
die Gemeinden
Stadt Langelsheim, Liebenburg, Stadt Seesen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Lutter am Barenberge |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hahausen, Flecken Lutter am Barenberge, Wallmoden |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 52) |
|
50
|
Braunschweig |
Kreisfreie Stadt Braunschweig |
|
51
|
Helmstedt – Wolfsburg |
Kreisfreie Stadt Wolfsburg |
|
|
|
Landkreis Helmstedt |
|
|
|
vom Landkreis Gifhorn |
|
|
|
|
das gemeindefreie Gebiet Giebel |
|
|
|
|
Samtgemeinde Boldecker Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck, Weyhausen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Brome |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bergfeld, Flecken Brome, Ehra-Lessien, Parsau, Rühen, Tiddische, Tülau |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 45) |
|
52
|
Goslar – Northeim – Osterode |
Vom Landkreis Göttingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Grund (Harz), Stadt Osterode am Harz, Walkenried und das gemeindefreie Gebiet Harz (Landkreis Göttingen) |
|
|
|
|
Samtgemeinde Hattorf am Harz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Elbingerode, Hattorf am Harz, Hörden am Harz, Wulften am Harz |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 53) |
|
|
|
vom Landkreis Goslar |
|
|
|
|
die Gemeinden
Stadt Bad Harzburg, Stadt Braunlage, Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld, Stadt Goslar und das gemeindefreie Gebiet Harz (Landkreis Goslar) |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 49) |
|
|
|
vom Landkreis Northeim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Stadt Bad Gandersheim, Stadt Dassel, Stadt Einbeck, Stadt Hardegsen, Kalefeld, Katlenburg-Lindau, Stadt Moringen, Flecken Nörten-Hardenberg, Stadt Northeim |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 46) |
|
53
|
Göttingen |
Vom Landkreis Göttingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Flecken Adelebsen, Stadt Bad Lauterberg im Harz, Stadt Bad Sachsa, Flecken Bovenden, Stadt Duderstadt, Friedland, Gleichen, Stadt Göttingen, Stadt Hann. Münden, Stadt Herzberg am Harz, Rosdorf, Staufenberg |
|
|
|
|
Samtgemeinde Dransfeld |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bühren, Stadt Dransfeld, Jühnde, Niemetal, Scheden |
|
|
|
|
Samtgemeinde Gieboldehausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bilshausen, Bodensee, Flecken Gieboldehausen, Krebeck, Obernfeld, Rhumspringe, Rollshausen, Rüdershausen, Wollbrandshausen, Wollershausen |
|
|
|
|
Samtgemeinde Radolfshausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ebergötzen, Landolfshausen, Seeburg, Seulingen, Waake |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 52) |
|
Bremen
|
|
54
|
Bremen I |
Von der kreisfreien Stadt Bremen |
|
|
|
|
der Stadtbezirk Ost (Ortsteile 311 bis 385 und Stadtteil Oberneuland) |
|
|
|
|
vom Stadtbezirk Mitte |
|
|
|
|
der Stadtteil
Mitte (Ortsteile 111 bis 113) |
|
|
|
|
vom Stadtbezirk Süd |
|
|
|
|
die Stadtteile
Neustadt, Obervieland, Huchting (Ortsteile 211 bis 244) |
|
|
|
(Übrige Stadt- und Ortsteile s. Wkr. 55) |
|
55
|
Bremen II – Bremerhaven |
Von der kreisfreien Stadt Bremen |
|
|
|
|
der Stadtbezirk West (Ortsteile 411 bis 445) |
|
|
|
|
der Stadtbezirk Nord (Ortsteile 511 bis 535) |
|
|
|
|
vom Stadtbezirk Mitte |
|
|
|
|
der Stadtteil
Häfen (Ortsteile 122 bis 125) |
|
|
|
|
vom Stadtbezirk Süd |
|
|
|
|
der Stadtteil
Woltmershausen (Ortsteile 251, 252) |
|
|
|
|
die Ortsteile
Seehausen, Strom (Ortsteile 261, 271) |
|
|
|
(Übrige Stadt- und Ortsteile s. Wkr. 54) |
|
|
|
kreisfreie Stadt Bremerhaven |
|
Brandenburg
|
|
56
|
Prignitz – Ostprignitz-Ruppin –
Havelland I |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin |
|
|
Landkreis Prignitz |
|
|
|
vom Landkreis Havelland |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinde Nauen |
|
|
|
|
Amt Friesack |
|
|
|
|
die Gemeinden
Friesack, Mühlenberge, Paulinenaue, Pessin, Retzow, Wiesenaue |
|
|
|
|
Amt Nennhausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Kotzen, Märkisch Luch, Nennhausen, Stechow-Ferchesar |
|
|
|
|
Amt Rhinow |
|
|
|
|
die Gemeinden
Gollenberg, Großderschau, Havelaue, Kleßen-Görne, Rhinow, Seeblick |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 58, 60) |
|
57
|
Uckermark – Barnim I |
Landkreis Uckermark |
|
|
|
vom Landkreis Barnim |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Eberswalde, Schorfheide, Wandlitz |
|
|
|
|
Amt Biesenthal-Barnim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Biesenthal, Breydin, Marienwerder, Melchow, Rüdnitz, Sydower Fließ |
|
|
|
|
Amt Britz-Chorin-Oderberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Britz, Chorin, Hohenfinow, Liepe, Lunow-Stolzenhagen, Niederfinow, Oderberg, Parsteinsee |
|
|
|
|
Amt Joachimsthal (Schorfheide) |
|
|
|
|
die Gemeinden
Althüttendorf, Friedrichswalde, Joachimsthal, Ziethen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 59) |
|
58
|
Oberhavel – Havelland II |
Landkreis Oberhavel |
|
|
|
vom Landkreis Havelland |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Brieselang, Dallgow-Döberitz, Falkensee, Ketzin/Havel, Schönwalde-Glien, Wustermark |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 56, 60) |
|
59
|
Märkisch-Oderland – Barnim II |
Landkreis Märkisch-Oderland |
|
|
|
vom Landkreis Barnim |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Ahrensfelde, Bernau bei Berlin, Panketal, Werneuchen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 57) |
|
60
|
Brandenburg an der Havel –
Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I |
Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel |
|
|
vom Landkreis Havelland |
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Milower Land, Premnitz, Rathenow |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 56, 58) |
|
|
|
vom Landkreis Potsdam-Mittelmark |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Bad Belzig, Beelitz, Groß Kreutz (Havel), Kloster Lehnin, Seddiner See, Treuenbrietzen, Werder (Havel), Wiesenburg/Mark |
|
|
|
|
Amt Beetzsee |
|
|
|
|
die Gemeinden
Beetzsee, Beetzseeheide, Havelsee, Päwesin, Roskow |
|
|
|
|
Amt Brück |
|
|
|
|
die Gemeinden
Borkheide, Borkwalde, Brück, Golzow, Linthe, Planebruch |
|
|
|
|
Amt Niemegk |
|
|
|
|
die Gemeinden
Mühlenfließ, Niemegk, Planetal, Rabenstein/Fläming |
|
|
|
|
Amt Wusterwitz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bensdorf, Rosenau, Wusterwitz |
|
|
|
|
Amt Ziesar |
|
|
|
|
die Gemeinden
Buckautal, Görzke, Gräben, Wenzlow, Wollin, Ziesar |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 61) |
|
|
|
vom Landkreis Teltow-Fläming |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Jüterbog, Niedergörsdorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 61, 62) |
|
61
|
Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II |
Kreisfreie Stadt Potsdam |
|
|
vom Landkreis Potsdam-Mittelmark |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Kleinmachnow, Michendorf, Nuthetal, Schwielowsee, Stahnsdorf, Teltow |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 60) |
|
|
|
vom Landkreis Teltow-Fläming |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinde Ludwigsfelde |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 60, 62) |
|
62
|
Dahme-Spreewald –
Teltow-Fläming III –
Oberspreewald-Lausitz I |
Landkreis Dahme-Spreewald |
|
|
vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz |
|
|
|
amtsfreie Gemeinde Lübbenau/Spreewald |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 65) |
|
|
|
vom Landkreis Teltow-Fläming |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Am Mellensee, Baruth/Mark, Blankenfelde-Mahlow, Großbeeren, Luckenwalde, Nuthe-Urstromtal, Rangsdorf, Trebbin, Zossen |
|
|
|
|
Amt Dahme/Mark |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dahme/Mark, Dahmetal, Ihlow, Niederer Fläming |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 60, 61) |
|
63
|
Frankfurt (Oder) – Oder-Spree |
Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) |
|
|
|
Landkreis Oder-Spree |
|
64
|
Cottbus – Spree-Neiße |
Kreisfreie Stadt Cottbus |
|
|
|
Landkreis Spree-Neiße |
|
65
|
Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II |
Landkreis Elbe-Elster |
|
|
|
vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz |
|
|
|
|
amtsfreie Gemeinden
Calau, Großräschen, Lauchhammer, Schipkau, Schwarzheide, Senftenberg, Vetschau/Spreewald |
|
|
|
|
Amt Altdöbern |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altdöbern, Bronkow, Luckaitztal, Neu-Seeland, Neupetershain |
|
|
|
|
Amt Ortrand |
|
|
|
|
die Gemeinden
Frauendorf, Großkmehlen, Kroppen, Lindenau, Ortrand, Tettau |
|
|
|
|
Amt Ruhland |
|
|
|
|
die Gemeinden
Grünewald, Guteborn, Hermsdorf, Hohenbocka, Ruhland, Schwarzbach |
|
|
|
(Übrige Gemeinde s. Wkr. 62) |
|
Sachsen-Anhalt
|
|
66
|
Altmark |
Altmarkkreis Salzwedel |
|
|
|
Landkreis Stendal |
|
67
|
Börde – Jerichower Land |
Landkreis Börde |
|
|
|
Landkreis Jerichower Land |
|
68
|
Harz |
Landkreis Harz |
|
|
|
vom Salzlandkreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aschersleben, Seeland |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 69, 71) |
|
69
|
Magdeburg |
Kreisfreie Stadt Magdeburg |
|
|
|
vom Salzlandkreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Barby, Bördeland, Calbe (Saale), Schönebeck (Elbe) |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 68, 71) |
|
70
|
Dessau – Wittenberg |
Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau |
|
|
|
Landkreis Wittenberg |
|
71
|
Anhalt |
Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
|
|
|
vom Salzlandkreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bernburg (Saale), Hecklingen, Könnern, Nienburg (Saale), Staßfurt |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Egelner Mulde |
|
|
|
|
die Gemeinden
Börde-Hakel, Bördeaue, Borne, Egeln, Wolmirsleben |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Saale-Wipper |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alsleben (Saale), Giersleben, Güsten, Ilberstedt, Plötzkau |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 68, 69) |
|
72
|
Halle |
Kreisfreie Stadt Halle (Saale) |
|
|
|
vom Saalekreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Kabelsketal, Landsberg, Petersberg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 73, 74) |
|
73
|
Burgenland – Saalekreis |
Burgenlandkreis |
|
|
|
vom Saalekreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Dürrenberg, Braunsbedra, Leuna, Schkopau |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 72, 74) |
|
74
|
Mansfeld |
Landkreis Mansfeld-Südharz |
|
|
|
vom Saalekreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Lauchstädt, Merseburg, Mücheln (Geiseltal), Querfurt, Salzatal, Teutschenthal, Wettin-Löbejün |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Weida-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Barnstädt, Farnstädt, Nemsdorf-Göhrendorf, Obhausen, Schraplau, Steigra |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 72, 73) |
|
Berlin
|
|
75
|
Berlin-Mitte |
Bezirk Mitte |
|
76
|
Berlin-Pankow |
Bezirk Pankow |
|
|
|
|
ohne das Gebiet östlich der Straßenmitte Prenzlauer Allee und südlich der Straßenmitte Lehderstraße und Gürtelstraße sowie des Jüdischen Friedhofs |
|
|
|
(Übriger Bezirk s. Wkr. 83) |
|
77
|
Berlin-Reinickendorf |
Bezirk Reinickendorf |
|
78
|
Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord |
Bezirk Spandau |
|
|
|
vom Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf |
|
|
|
|
das Gebiet nördlich der Spree |
|
|
|
(Übriger Bezirk s. Wkr. 80) |
|
79
|
Berlin-Steglitz-Zehlendorf |
Bezirk Steglitz-Zehlendorf |
|
80
|
Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf |
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf |
|
|
|
|
ohne das Gebiet nördlich der Spree |
|
|
|
(Übriger Bezirk s. Wkr. 78) |
|
81
|
Berlin-Tempelhof-Schöneberg |
Bezirk Tempelhof-Schöneberg |
|
82
|
Berlin-Neukölln |
Bezirk Neukölln |
|
83
|
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost |
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg |
|
|
vom Bezirk Pankow |
|
|
|
|
das Gebiet östlich der Straßenmitte Prenzlauer Allee und südlich der Straßenmitte Lehderstraße und Gürtelstraße sowie des Jüdischen Friedhofs |
|
|
|
(Übriger Bezirk s. Wkr. 76) |
|
84
|
Berlin-Treptow-Köpenick |
Bezirk Treptow-Köpenick |
|
85
|
Berlin-Marzahn-Hellersdorf |
Bezirk Marzahn-Hellersdorf |
|
86
|
Berlin-Lichtenberg |
Bezirk Lichtenberg |
|
Nordrhein-Westfalen
|
|
87
|
Aachen I |
Von der Städteregion Aachen |
|
|
|
|
die Stadt Aachen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 88) |
|
88
|
Aachen II |
Von der Städteregion Aachen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Roetgen, Simmerath, Stollberg (Rhld.), Würselen |
|
|
|
(Übrige Gemeinde s. Wkr. 87) |
|
89
|
Heinsberg |
Kreis Heinsberg |
|
90
|
Düren |
Kreis Düren |
|
91
|
Rhein-Erft-Kreis I |
Vom Rhein-Erft-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Frechen, Hürth, Kerpen, Pulheim |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 92) |
|
92
|
Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II |
Kreis Euskirchen |
|
|
|
vom Rhein-Erft-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Brühl, Erftstadt, Wesseling |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 91) |
|
93
|
Köln I |
Von der kreisfreien Stadt Köln |
|
|
|
|
vom Stadtbezirk 1 Innenstadt |
|
|
|
|
die Stadtteile
Altstadt-Nord, Deutz, Neustadt-Nord |
|
|
|
(Übrige Stadtteile s. Wkr. 94) |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
7 Porz, 8 Kalk |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 94, 95, 101) |
|
94
|
Köln II |
Von der kreisfreien Stadt Köln |
|
|
|
|
vom Stadtbezirk 1 Innenstadt |
|
|
|
|
die Stadtteile
Altstadt-Süd, Neustadt-Süd |
|
|
|
(Übrige Stadtteile s. Wkr. 93) |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
2 Rodenkirchen, 3 Lindenthal |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 93, 95, 101) |
|
95
|
Köln III |
Von der kreisfreien Stadt Köln |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
4 Ehrenfeld, 5 Nippes, 6 Chorweiler |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 93, 94, 101) |
|
96
|
Bonn |
Kreisfreie Stadt Bonn |
|
97
|
Rhein-Sieg-Kreis I |
Vom Rhein-Sieg-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Eitorf, Hennef (Sieg), Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Niederkassel, Ruppichteroth, Siegburg, Troisdorf, Windeck |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 98) |
|
98
|
Rhein-Sieg-Kreis II |
Vom Rhein-Sieg-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alfter, Bad Honnef, Bornheim, Königswinter, Meckenheim, Rheinbach, Sankt Augustin, Swisttal, Wachtberg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 97) |
|
99
|
Oberbergischer Kreis |
Oberbergischer Kreis |
|
100
|
Rheinisch-Bergischer Kreis |
Rheinisch-Bergischer Kreis |
|
101
|
Leverkusen – Köln IV |
Kreisfreie Stadt Leverkusen |
|
|
|
von der kreisfreien Stadt Köln |
|
|
|
|
der Stadtbezirk 9 Mülheim |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 93, 94, 95) |
|
102
|
Wuppertal I |
Von der kreisfreien Stadt Wuppertal |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
0 Elberfeld, 1 Elberfeld West, 2 Uellendahl-Katernberg, 3 Vohwinkel, 5 Barmen, 6 Oberbarmen, 7 Heckinghausen, 8 Langerfeld-Beyenburg |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 103) |
|
103
|
Solingen – Remscheid – Wuppertal II |
Kreisfreie Stadt Remscheid |
|
|
Kreisfreie Stadt Solingen |
|
|
|
von der kreisfreien Stadt Wuppertal |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
4 Cronenberg, 9 Ronsdorf |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 102) |
|
104
|
Mettmann I |
Vom Kreis Mettmann |
|
|
|
|
die Gemeinden
Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld (Rheinland), Mettmann, Monheim am Rhein |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 105) |
|
105
|
Mettmann II |
Vom Kreis Mettmann |
|
|
|
|
die Gemeinden
Heiligenhaus, Ratingen, Velbert, Wülfrath |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 104) |
|
106
|
Düsseldorf I |
Von der kreisfreien Stadt Düsseldorf |
|
|
|
|
die Stadtbezirke 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 107) |
|
107
|
Düsseldorf II |
Von der kreisfreien Stadt Düsseldorf |
|
|
|
|
die Stadtbezirke 3, 8, 9, 10 |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 106) |
|
108
|
Neuss I |
Vom Rhein-Kreis Neuss |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dormagen, Grevenbroich, Neuss, Rommerskirchen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 110) |
|
109
|
Mönchengladbach |
Kreisfreie Stadt Mönchengladbach |
|
110
|
Krefeld I – Neuss II |
Von der kreisfreien Stadt Krefeld |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
1 West, 5 Süd, 6 Fischeln, 7 Oppum-Linn, 9 Uerdingen |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 114) |
|
|
|
vom Rhein-Kreis Neuss |
|
|
|
|
die Gemeinden
Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 108) |
|
111
|
Viersen |
Kreis Viersen |
|
112
|
Kleve |
Kreis Kleve |
|
113
|
Wesel I |
Vom Kreis Wesel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde (Niederrhein), Wesel, Xanten |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 114, 117) |
|
114
|
Krefeld II – Wesel II |
Von der kreisfreien Stadt Krefeld |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
2 Nord, 3 Hüls, 4 Mitte, 8 Ost |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 110) |
|
|
|
vom Kreis Wesel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Moers, Neukirchen-Vluyn |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 113, 117) |
|
115
|
Duisburg I |
Von der kreisfreien Stadt Duisburg |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
600 Rheinhausen, 700 Süd |
|
|
|
|
vom Stadtbezirk 500 Mitte |
|
|
|
|
die Stadtteile
501 Altstadt, 502 Neuenkamp, 503 Kaßlerfeld, 505 Neudorf-Nord, 506 Neudorf-Süd, 507 Dellviertel, 508 Hochfeld, 509 Wanheimerort |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke und der Stadtteil 504 Duissern des Stadtbezirks Mitte s. Wkr. 116) |
|
116
|
Duisburg II |
Von der kreisfreien Stadt Duisburg |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
100 Walsum, 200 Hamborn, 300 Meiderich/Beeck, 400 Homberg/Ruhrort/Baerl |
|
|
|
|
vom Stadtbezirk 500 Mitte |
|
|
|
|
der Stadtteil 504 Duissern |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke und Stadtteile des Stadtbezirks Mitte s. Wkr. 115) |
|
117
|
Oberhausen – Wesel III |
Kreisfreie Stadt Oberhausen |
|
|
|
vom Kreis Wesel |
|
|
|
|
die Gemeinde Dinslaken |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 113, 114) |
|
118
|
Mülheim – Essen I |
Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr |
|
|
|
von der kreisfreien Stadt Essen |
|
|
|
|
der Stadtbezirk IV |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 119, 120) |
|
119
|
Essen II |
Von der kreisfreien Stadt Essen |
|
|
|
|
die Stadtbezirke I, V, VI, VII |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 118, 120) |
|
120
|
Essen III |
Von der kreisfreien Stadt Essen |
|
|
|
|
die Stadtbezirke II, III, VIII, IX |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 118, 119) |
|
121
|
Recklinghausen I |
Vom Kreis Recklinghausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Waltrop |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 122, 125) |
|
122
|
Recklinghausen II |
Vom Kreis Recklinghausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Datteln, Haltern am See, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 121, 125) |
|
123
|
Gelsenkirchen |
Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen |
|
124
|
Steinfurt I – Borken I |
Vom Kreis Borken |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ahaus, Gronau (Westf.), Heek, Legden, Schöppingen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 126) |
|
|
|
vom Kreis Steinfurt |
|
|
|
|
die Gemeinden
Horstmar, Metelen, Neuenkirchen, Ochtrup, Rheine, Steinfurt, Wettringen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 127, 128) |
|
125
|
Bottrop – Recklinghausen III |
Kreisfreie Stadt Bottrop |
|
|
|
vom Kreis Recklinghausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dorsten, Gladbeck |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 121, 122) |
|
126
|
Borken II |
Vom Kreis Borken |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bocholt, Borken, Gescher, Heiden, Isselburg, Raesfeld, Reken, Rhede, Stadtlohn, Südlohn, Velen, Vreden |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 124) |
|
127
|
Coesfeld – Steinfurt II |
Kreis Coesfeld |
|
|
|
vom Kreis Steinfurt |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altenberge, Laer, Nordwalde |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 124, 128) |
|
128
|
Steinfurt III |
Vom Kreis Steinfurt |
|
|
|
|
die Gemeinden
Emsdetten, Greven, Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, Mettingen, Recke, Saerbeck, Tecklenburg, Westerkappeln |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 124, 127) |
|
129
|
Münster |
Kreisfreie Stadt Münster |
|
130
|
Warendorf |
Kreis Warendorf |
|
131
|
Gütersloh I |
Vom Kreis Gütersloh |
|
|
|
|
die Gemeinden
Borgholzhausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Steinhagen, Verl, Versmold |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 132, 136) |
|
132
|
Bielefeld – Gütersloh II |
Kreisfreie Stadt Bielefeld |
|
|
|
vom Kreis Gütersloh |
|
|
|
|
die Gemeinde Werther (Westf.) |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 131, 136) |
|
133
|
Herford – Minden-Lübbecke II |
Kreis Herford |
|
|
|
vom Kreis Minden-Lübbecke |
|
|
|
|
die Gemeinde Bad Oeynhausen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 134) |
|
134
|
Minden-Lübbecke I |
Vom Kreis Minden-Lübbecke |
|
|
|
|
die Gemeinden
Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Minden, Petershagen, Porta Westfalica, Preußisch Oldendorf, Rahden, Stemwede |
|
|
|
(Übrige Gemeinde s. Wkr. 133) |
|
135
|
Lippe I |
Vom Kreis Lippe |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Salzuflen, Barntrup, Blomberg, Detmold, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe, Oerlinghausen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 136) |
|
136
|
Höxter – Gütersloh III – Lippe II |
Kreis Höxter |
|
|
|
vom Kreis Gütersloh |
|
|
|
|
die Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 131, 132) |
|
|
|
vom Kreis Lippe |
|
|
|
|
die Gemeinden
Augustdorf, Horn-Bad Meinberg, Lügde, Schieder-Schwalenberg, Schlangen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 135) |
|
137
|
Paderborn |
Kreis Paderborn |
|
138
|
Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I |
Kreisfreie Stadt Hagen |
|
|
|
vom Ennepe-Ruhr-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 139) |
|
139
|
Ennepe-Ruhr-Kreis II |
Vom Ennepe-Ruhr-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter (Ruhr), Witten |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 138) |
|
140
|
Bochum I |
Von der kreisfreien Stadt Bochum |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
1 Bochum-Mitte, 2 Bochum-Wattenscheid, 5 Bochum-Süd, 6 Bochum-Südwest |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 141) |
|
141
|
Herne – Bochum II |
Kreisfreie Stadt Herne |
|
|
|
von der kreisfreien Stadt Bochum |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
3 Bochum-Nord, 4 Bochum-Ost |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 140) |
|
142
|
Dortmund I |
Von der kreisfreien Stadt Dortmund |
|
|
|
|
vom Stadtbezirk 0 Innenstadt |
|
|
|
|
die Stadtteile
Innenstadt-West, Innenstadt-Ost |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
6 Hombruch, 8 Huckarde, 7 Lütgendortmund, 9 Mengede |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke und übriger Stadtteil s. Wkr. 143) |
|
143
|
Dortmund II |
Von der kreisfreien Stadt Dortmund |
|
|
|
|
vom Stadtbezirk 0 Innenstadt |
|
|
|
|
der Stadtteil Innenstadt-Nord |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
4 Aplerbeck, 3 Brackel, 1 Eving, 5 Hörde, 2 Scharnhorst |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke und Stadtteile s. Wkr. 142) |
|
144
|
Unna I |
Vom Kreis Unna |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bergkamen, Bönen, Fröndenberg/Ruhr, Holzwickede, Kamen, Schwerte, Unna |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 145) |
|
145
|
Hamm – Unna II |
Kreisfreie Stadt Hamm |
|
|
|
vom Kreis Unna |
|
|
|
|
die Gemeinden
Lünen, Selm, Werne |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 144) |
|
146
|
Soest |
Kreis Soest |
|
147
|
Hochsauerlandkreis |
Hochsauerlandkreis |
|
148
|
Siegen-Wittgenstein |
Kreis Siegen-Wittgenstein |
|
149
|
Olpe – Märkischer Kreis I |
Kreis Olpe |
|
|
|
vom Märkischen Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Schalksmühle |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 150) |
|
150
|
Märkischer Kreis II |
Vom Märkischen Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altena, Balve, Hemer, Iserlohn, Menden (Sauerland), Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg, Werdohl |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 149) |
|
Sachsen
|
|
151
|
Nordsachsen |
Landkreis Nordsachsen |
|
152
|
Leipzig I |
Von der kreisfreien Stadt Leipzig |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
Alt-West, Nord, Nordost, Nordwest, Ost |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 153) |
|
153
|
Leipzig II |
Von der kreisfreien Stadt Leipzig |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
Mitte, Süd, Südost, Südwest, West |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 152) |
|
154
|
Leipzig-Land |
Landkreis Leipzig |
|
155
|
Meißen |
Landkreis Meißen |
|
156
|
Bautzen I |
Vom Landkreis Bautzen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bautzen, Bernsdorf, Burkau, Cunewalde, Demitz-Thumitz, Doberschau-Gaußig, Elsterheide, Elstra, Göda, Großdubrau, Haselbachtal, Hochkirch, Hoyerswerda, Kamenz, Königswartha, Kubschütz, Lauta, Lohsa, Malschwitz, Neukirch/Lausitz, Oßling, Radibor, Schirgiswalde-Kirschau, Schmölln-Putzkau, Schwepnitz, Sohland a. d. Spree, Spreetal, Steinigtwolmsdorf, Weißenberg, Wilthen, Wittichenau |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Bischofswerda |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bischofswerda, Rammenau |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Großharthau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Frankenthal, Großharthau |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Großpostwitz/O.L. |
|
|
|
|
die Gemeinden
Großpostwitz/O.L., Obergurig |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Königsbrück |
|
|
|
|
die Gemeinden
Königsbrück, Laußnitz, Neukirch |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Neschwitz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Neschwitz, Puschwitz |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Großnaundorf, Lichtenberg, Ohorn, Pulsnitz, Steina |
|
|
|
|
Verwaltungsverband Am Klosterwasser |
|
|
|
|
die Gemeinden
Crostwitz, Nebelschütz, Panschwitz-Kuckau, Räckelwitz, Ralbitz-Rosenthal |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 160) |
|
157
|
Görlitz |
Landkreis Görlitz |
|
158
|
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
|
159
|
Dresden I |
Von der kreisfreien Stadt Dresden |
|
|
|
|
die Ortsamtsbereiche
Altstadt, Blasewitz, Leuben, Plauen, Prohlis |
|
|
|
(Übrige Ortsamtsbereiche und Ortschaften s. Wkr. 160) |
|
160
|
Dresden II – Bautzen II |
Von der kreisfreien Stadt Dresden |
|
|
|
|
die Ortsamtsbereiche
Cotta, Klotzsche, Loschwitz, Neustadt, Pieschen |
|
|
|
|
die Ortschaften
Altfranken, Cossebaude, Gompitz, Langebrück, Mobschatz, Oberwartha, Schönborn, Schönfeld-Weißig, Weixdorf |
|
|
|
(Übrige Ortsamtsbereiche s. Wkr. 159) |
|
|
|
vom Landkreis Bautzen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Arnsdorf, Großröhrsdorf, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Wachau |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 156) |
|
161
|
Mittelsachsen |
Vom Landkreis Mittelsachsen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Augustusburg, Bobritzsch-Hilbersdorf, Brand-Erbisdorf, Döbeln, Eppendorf, Flöha, Frankenberg/Sa., Frauenstein, Freiberg, Großhartmannsdorf, Großschirma, Großweitzschen, Hainichen, Halsbrücke, Hartha, Kriebstein, Leisnig, Leubsdorf, Mulda/Sa., Neuhausen/Erzgeb., Niederwiesa, Oberschöna, Oederan, Rechenberg-Bienenmühle, Reinsberg, Rossau, Roßwein, Striegistal, Waldheim |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Lichtenberg-Weißenborn |
|
|
|
|
die Gemeinden
Lichtenberg/Erzgeb., Weißenborn/Erzgeb. |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Mittweida |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altmittweida, Mittweida |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Ostrau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ostrau, Zschaitz-Ottewig |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Sayda/Dorfchemnitz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dorfchemnitz, Sayda |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 163) |
|
162
|
Chemnitz |
Kreisfreie Stadt Chemnitz |
|
163
|
Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II |
Vom Erzgebirgskreis |
|
|
|
die Gemeinden
Hohndorf, Jahnsdorf/Erzgeb., Neukirchen/Erzgeb., Oelsnitz/Erzgeb., Thalheim/Erzgeb. |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Burkhardtsdorf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Auerbach, Burkhardtsdorf, Gornsdorf |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Lugau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Lugau/Erzgeb., Niederwürschnitz |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Stollberg/Erzgeb. |
|
|
|
|
die Gemeinden
Niederdorf, Stollberg/Erzgeb. |
|
|
|
|
von der Verwaltungsgemeinschaft Zwönitz |
|
|
|
|
die Gemeinde Zwönitz |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 164) |
|
|
|
vom Landkreis Mittelsachsen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Claußnitz, Erlau, Geringswalde, Hartmannsdorf, Königshain-Wiederau, Lichtenau, Lunzenau, Penig, Wechselburg |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Burgstädt |
|
|
|
|
die Gemeinden
Burgstädt, Mühlau, Taura |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Rochlitz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Königsfeld, Rochlitz, Seelitz, Zettlitz |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 161) |
|
|
|
vom Landkreis Zwickau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Callenberg, Gersdorf, Hohenstein-Ernstthal, Oberlungwitz |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Limbach-Oberfrohna |
|
|
|
|
die Gemeinden
Limbach-Oberfrohna, Niederfrohna |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Rund um den Auersberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bernsdorf, Lichtenstein/Sa., St. Egidien |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 165) |
|
164
|
Erzgebirgskreis I |
Vom Erzgebirgskreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Amtsberg, Annaberg-Buchholz, Aue-Bad Schlema, Breitenbrunn/Erzgeb., Crottendorf, Drebach, Ehrenfriedersdorf, Eibenstock, Gelenau/Erzgeb., Großolbersdorf, Großrückerswalde, Grünhain-Beierfeld, Jöhstadt, Johanngeorgenstadt, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Marienberg, Mildenau, Kurort Oberwiesenthal, Olbernhau, Pockau-Lengefeld, Raschau-Markersbach, Schneeberg, Schönheide, Schwarzenberg/Erzgeb., Sehmatal, Stützengrün, Thermalbad Wiesenbad, Thum, Wolkenstein |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Bärenstein-Königswalde |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bärenstein, Königswalde |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Geyer |
|
|
|
|
die Gemeinden
Geyer, Tannenberg |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Scheibenberg-Schlettau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Scheibenberg, Schlettau |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Seiffen/Erzgeb. |
|
|
|
|
die Gemeinden
Deutschneudorf, Heidersdorf, Kurort Seiffen/Erzgeb. |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Zschopau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Gornau/Erzgeb., Zschopau |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Zschorlau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bockau, Zschorlau |
|
|
|
|
von der Verwaltungsgemeinschaft Zwönitz |
|
|
|
|
die Gemeinde Elterlein |
|
|
|
|
Verwaltungsverband Wildenstein |
|
|
|
|
die Gemeinden
Börnichen/Erzgeb., Grünhainichen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 163) |
|
165
|
Zwickau |
Vom Landkreis Zwickau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Fraureuth, Glauchau, Hartenstein, Langenbernsdorf, Langenweißbach, Lichtentanne, Mülsen, Neukirchen/Pleiße, Reinsdorf, Werdau, Wildenfels, Wilkau-Haßlau, Zwickau |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Crimmitschau-Dennheritz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Crimmitschau, Dennheritz |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Crinitzberg, Hartmannsdorf b. Kirchberg, Hirschfeld, Kirchberg |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Meerane-Schönberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Meerane, Schönberg |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Waldenburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Oberwiera, Remse, Waldenburg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 163) |
|
166
|
Vogtlandkreis |
Vogtlandkreis |
|
Hessen
|
|
167
|
Waldeck |
Vom Landkreis Kassel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Emstal, Bad Karlshafen, Baunatal, Breuna, Calden, Grebenstein, Habichtswald, Hofgeismar, Immenhausen, Liebenau, Naumburg, Reinhardshagen, Schauenburg, Trendelburg, Wesertal, Wolfhagen, Zierenberg und der Gutsbezirk Reinhardswald |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 168) |
|
|
|
vom Landkreis Waldeck-Frankenberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Diemelstadt, Edertal, Korbach, Lichtenfels, Twistetal, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland) |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 170) |
|
168
|
Kassel |
Kreisfreie Stadt Kassel |
|
|
|
vom Landkreis Kassel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ahnatal, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Helsa, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Söhrewald, Vellmar |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 167) |
|
169
|
Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg |
|
|
Werra-Meißner-Kreis |
|
170
|
Schwalm-Eder |
Schwalm-Eder-Kreis |
|
|
|
vom Landkreis Waldeck-Frankenberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Allendorf (Eder), Battenberg (Eder), Bromskirchen, Burgwald, Frankenau, Frankenberg (Eder), Gemünden (Wohra), Haina (Kloster), Hatzfeld (Eder), Rosenthal, Vöhl |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 167) |
|
171
|
Marburg |
Landkreis Marburg-Biedenkopf |
|
172
|
Lahn-Dill |
Lahn-Dill-Kreis |
|
|
|
vom Landkreis Gießen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Biebertal, Wettenberg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 173) |
|
173
|
Gießen |
Vom Landkreis Gießen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Allendorf (Lumda), Buseck, Fernwald, Gießen, Grünberg, Heuchelheim a. d. Lahn, Hungen, Langgöns, Laubach, Lich, Linden, Lollar, Pohlheim, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 172) |
|
|
|
vom Vogelsbergkreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alsfeld, Antrifttal, Feldatal, Gemünden (Felda), Homberg (Ohm), Kirtorf, Mücke, Romrod |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 174, 175) |
|
174
|
Fulda |
Landkreis Fulda |
|
|
|
vom Vogelsbergkreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Freiensteinau, Grebenau, Grebenhain, Herbstein, Lauterbach (Hessen), Lautertal (Vogelsberg), Schlitz, Schwalmtal, Ulrichstein, Wartenberg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 173, 175) |
|
175
|
Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten |
Vom Main-Kinzig-Kreis |
|
|
|
die Gemeinden
Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Biebergemünd, Birstein, Brachttal, Flörsbachtal, Freigericht, Gelnhausen, Gründau, Jossgrund, Linsengericht, Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der Straße, Wächtersbach und der Gutsbezirk Spessart |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 180) |
|
|
|
vom Vogelsbergkreis |
|
|
|
|
die Gemeinde Schotten |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 173, 174) |
|
|
|
vom Wetteraukreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altenstadt, Büdingen, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Ortenberg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 177) |
|
176
|
Hochtaunus |
Vom Hochtaunuskreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Homburg v. d. Höhe, Friedrichsdorf, Glashütten, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Oberursel (Taunus), Schmitten, Usingen, Wehrheim, Weilrod |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 181) |
|
|
|
vom Landkreis Limburg-Weilburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Beselich, Löhnberg, Mengerskirchen, Merenberg, Runkel, Villmar, Weilburg, Weilmünster, Weinbach |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 178) |
|
177
|
Wetterau I |
Vom Wetteraukreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach, Echzell, Florstadt, Friedberg (Hessen), Karben, Münzenberg, Nidda, Niddatal, Ober-Mörlen, Ranstadt, Reichelsheim (Wetterau), Rockenberg, Rosbach v. d. Höhe, Wölfersheim, Wöllstadt |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 175) |
|
178
|
Rheingau-Taunus – Limburg |
Rheingau-Taunus-Kreis |
|
|
|
vom Landkreis Limburg-Weilburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Camberg, Brechen, Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Hünfelden, Limburg a. d. Lahn, Selters (Taunus), Waldbrunn (Westerwald) |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 176) |
|
179
|
Wiesbaden |
Kreisfreie Stadt Wiesbaden |
|
180
|
Hanau |
Vom Main-Kinzig-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bruchköbel, Erlensee, Großkrotzenburg, Hammersbach, Hanau, Hasselroth, Langenselbold, Maintal, Neuberg, Nidderau, Niederdorfelden, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 175) |
|
181
|
Main-Taunus |
Main-Taunus-Kreis |
|
|
|
vom Hochtaunuskreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Steinbach (Taunus) |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 176) |
|
182
|
Frankfurt am Main I |
Von der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main |
|
|
|
|
die Ortsteile
Altstadt, Bahnhofsviertel, Bockenheim, Dornbusch, Eschersheim, Gallusviertel, Ginnheim, Griesheim, Gutleutviertel, Hausen, Heddernheim, Höchst, Innenstadt, Nied, Niederursel, Praunheim, Rödelheim, Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach, Westend, Zeilsheim |
|
|
|
(Übrige Ortsteile s. Wkr. 183) |
|
183
|
Frankfurt am Main II |
Von der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main |
|
|
|
|
die Ortsteile
Bergen-Enkheim, Berkersheim, Bonames, Bornheim, Eckenheim, Fechenheim, Frankfurter Berg, Harheim, Kalbach, Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach, Niederrad, Nordend, Oberrad, Ostend, Preungesheim, Riederwald, Sachsenhausen, Schwanheim, Seckbach |
|
|
|
(Übrige Ortsteile s. Wkr. 182) |
|
184
|
Groß-Gerau |
Landkreis Groß-Gerau |
|
185
|
Offenbach |
Kreisfreie Stadt Offenbach am Main |
|
|
|
vom Landkreis Offenbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dietzenbach, Dreieich, Egelsbach, Heusenstamm, Langen (Hessen), Mühlheim am Main, Neu-Isenburg, Obertshausen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 187) |
|
186
|
Darmstadt |
Kreisfreie Stadt Darmstadt |
|
|
|
vom Landkreis Darmstadt-Dieburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alsbach-Hähnlein, Bickenbach, Eppertshausen, Erzhausen, Griesheim, Messel, Modautal, Mühltal, Münster (Hessen), Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Roßdorf, Seeheim-Jugenheim, Weiterstadt |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 187) |
|
187
|
Odenwald |
Odenwaldkreis |
|
|
|
vom Landkreis Darmstadt-Dieburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Babenhausen, Dieburg, Fischbachtal, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Otzberg, Reinheim, Schaafheim |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 186) |
|
|
|
vom Landkreis Offenbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hainburg, Mainhausen, Rodgau, Rödermark, Seligenstadt |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 185) |
|
188
|
Bergstraße |
Landkreis Bergstraße |
|
Thüringen
|
|
189
|
Eichsfeld – Nordhausen –
Kyffhäuserkreis |
Landkreis Eichsfeld |
|
|
Landkreis Kyffhäuserkreis |
|
|
|
Landkreis Nordhausen |
|
190
|
Eisenach – Wartburgkreis –
Unstrut-Hainich-Kreis |
Kreisfreie Stadt Eisenach |
|
|
Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis |
|
|
|
Landkreis Wartburgkreis |
|
191
|
Jena – Sömmerda – Weimarer Land I |
Kreisfreie Stadt Jena |
|
|
Landkreis Sömmerda |
|
|
|
vom Landkreis Weimarer Land |
|
|
|
|
verwaltungsgemeinschaftsfreie Gemeinden
Apolda, Bad Berka, Blankenhain, Ilmtal-Weinstraße |
|
|
|
|
Erfüllende Gemeinde Am Ettersberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Am Ettersberg, Ballstedt, Ettersburg, Neumark |
|
|
|
|
Erfüllende Gemeinde Bad Sulza |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Sulza, Eberstedt, Großheringen, Niedertrebra, Obertrebra, Rannstedt, Schmiedehausen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hohenfelden, Klettbach, Kranichfeld, Nauendorf, Rittersdorf, Tonndorf |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Mellingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Buchfart, Döbritschen, Frankendorf, Großschwabhausen, Hammerstedt, Hetschburg, Kapellendorf, Kiliansroda, Kleinschwabhausen, Lehnstedt, Magdala, Mechelroda, Mellingen, Oettern, Umpferstedt, Vollersroda, Wiegendorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 193) |
|
192
|
Gotha – Ilm-Kreis |
Landkreis Gotha |
|
|
|
Landkreis Ilm-Kreis |
|
193
|
Erfurt – Weimar – Weimarer Land II |
Kreisfreie Stadt Erfurt |
|
|
|
Kreisfreie Stadt Weimar |
|
|
|
vom Landkreis Weimarer Land |
|
|
|
|
verwaltungsgemeinschaftsfreie Gemeinde Grammetal |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 191) |
|
194
|
Gera – Greiz – Altenburger Land |
Kreisfreie Stadt Gera |
|
|
|
Landkreis Altenburger Land |
|
|
|
Landkreis Greiz |
|
195
|
Saalfeld-Rudolstadt –
Saale-Holzland-Kreis –
Saale-Orla-Kreis |
Landkreis Saale-Holzland-Kreis |
|
|
Landkreis Saale-Orla-Kreis |
|
|
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt |
|
196
|
Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg |
Kreisfreie Stadt Suhl |
|
|
Landkreis Hildburghausen |
|
|
|
Landkreis Schmalkalden-Meiningen |
|
|
|
Landkreis Sonneberg |
|
Rheinland-Pfalz
|
|
197
|
Neuwied |
Landkreis Altenkirchen (Westerwald) |
|
|
|
Landkreis Neuwied |
|
198
|
Ahrweiler |
Landkreis Ahrweiler |
|
|
|
vom Landkreis Mayen-Koblenz |
|
|
|
|
verbandsfreie Gemeinden
Andernach, Mayen |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Maifeld |
|
|
|
|
die Gemeinden
Einig, Gappenach, Gering, Gierschnach, Kalt, Kerben, Kollig, Lonnig, Mertloch, Münstermaifeld, Naunheim, Ochtendung, Pillig, Polch, Rüber, Trimbs, Welling, Wierschem |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Mendig |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bell, Mendig, Rieden, Thür, Volkesfeld |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Pellenz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Kretz, Kruft, Nickenich, Plaidt, Saffig |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Vordereifel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Acht, Anschau, Arft, Baar, Bermel, Boos, Ditscheid, Ettringen, Hausten, Herresbach, Hirten, Kehrig, Kirchwald, Kottenheim, Langenfeld, Langscheid, Lind, Luxem, Monreal, Münk, Nachtsheim, Reudelsterz, Sankt Johann, Siebenbach, Virneburg, Weiler, Welschenbach |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 199) |
|
199
|
Koblenz |
Kreisfreie Stadt Koblenz |
|
|
|
vom Landkreis Mayen-Koblenz |
|
|
|
|
verbandsfreie Gemeinde Bendorf |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Rhein-Mosel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alken, Brey, Brodenbach, Burgen, Dieblich, Hatzenport, Kobern-Gondorf, Lehmen, Löf, Macken, Niederfell, Nörtershausen, Oberfell, Rhens, Spay, Waldesch, Winningen, Wolken |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Vallendar |
|
|
|
|
die Gemeinden
Niederwerth, Urbar, Vallendar, Weitersburg |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Weißenthurm |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bassenheim, Kaltenengers, Kettig, Mülheim-Kärlich, Sankt Sebastian, Urmitz, Weißenthurm |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 198) |
|
|
|
vom Rhein-Lahn-Kreis |
|
|
|
|
verbandsfreie Gemeinde Lahnstein |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Loreley |
|
|
|
|
die Gemeinden
Auel, Bornich, Braubach, Dachsenhausen, Dahlheim, Dörscheid, Filsen, Kamp-Bornhofen, Kaub, Kestert, Lierschied, Lykershausen, Nochern, Osterspai, Patersberg, Prath, Reichenberg, Reitzenhain, Loreleystadt Sankt Goarshausen, Sauerthal, Weisel, Weyer |
|
|
|
|
von der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Arzbach, Bad Ems, Becheln, Dausenau, Fachbach, Frücht, Kemmenau, Miellen, Nievern |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 204) |
|
200
|
Mosel/Rhein-Hunsrück |
Landkreis Cochem-Zell |
|
|
|
Rhein-Hunsrück-Kreis |
|
|
|
vom Landkreis Bernkastel-Wittlich |
|
|
|
|
verbandsfreie Gemeinde Morbach |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bernkastel-Kues, Brauneberg, Burgen, Erden, Gornhausen, Graach an der Mosel, Hochscheid, Kesten, Kleinich, Kommen, Lieser, Lösnich, Longkamp, Maring-Noviand, Minheim, Monzelfeld, Mülheim (Mosel), Neumagen-Dhron, Piesport, Ürzig, Veldenz, Wintrich, Zeltingen-Rachtig |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Berglicht, Breit, Büdlich, Burtscheid, Deuselbach, Dhronecken, Etgert, Gielert, Gräfendhron, Heidenburg, Hilscheid, Horath, Immert, Lückenburg, Malborn, Merschbach, Neunkirchen, Rorodt, Schönberg, Talling, Thalfang |
|
|
|
|
von der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Burg (Mosel), Enkirch, Irmenach, Lötzbeuren, Starkenburg, Traben-Trarbach |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 202) |
|
201
|
Kreuznach |
Landkreis Bad Kreuznach |
|
|
|
Landkreis Birkenfeld |
|
202
|
Bitburg |
Eifelkreis Bitburg-Prüm |
|
|
|
Landkreis Vulkaneifel |
|
|
|
vom Landkreis Bernkastel-Wittlich |
|
|
|
|
verbandsfreie Gemeinde Wittlich |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Wittlich-Land |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altrich, Arenrath, Bergweiler, Bettenfeld, Binsfeld, Bruch, Dierfeld, Dierscheid, Dodenburg, Dreis, Eckfeld, Eisenschmitt, Esch, Gipperath, Gladbach, Greimerath, Großlittgen, Hasborn, Heckenmünster, Heidweiler, Hetzerath, Hupperath, Karl, Klausen, Landscheid, Laufeld, Manderscheid, Meerfeld, Minderlittgen, Musweiler, Niederöfflingen, Niederscheidweiler, Niersbach, Oberöfflingen, Oberscheidweiler, Osann-Monzel, Pantenburg, Platten, Plein, Rivenich, Salmtal, Schladt, Schwarzenborn, Sehlem, Wallscheid |
|
|
|
|
von der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bausendorf, Bengel, Diefenbach, Flußbach, Hontheim, Kinderbeuern, Kinheim, Kröv, Reil, Willwerscheid |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 200) |
|
203
|
Trier |
Kreisfreie Stadt Trier |
|
|
|
Landkreis Trier-Saarburg |
|
204
|
Montabaur |
Westerwaldkreis |
|
|
|
vom Rhein-Lahn-Kreis |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Aar-Einrich |
|
|
|
|
die Gemeinden
Allendorf, Berghausen, Berndroth, Biebrich, Bremberg, Burgschwalbach, Dörsdorf, Ebertshausen, Eisighofen, Ergeshausen, Flacht, Gutenacker, Hahnstätten, Herold, Kaltenholzhausen, Katzenelnbogen, Klingelbach, Kördorf, Lohrheim, Mittelfischbach, Mudershausen, Netzbach, Niederneisen, Niedertiefenbach, Oberfischbach, Oberneisen, Reckenroth, Rettert, Roth, Schiesheim, Schönborn |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Diez |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altendiez, Aull, Balduinstein, Birlenbach, Charlottenberg, Cramberg, Diez, Dörnberg, Eppenrod, Geilnau, Gückingen, Hambach, Heistenbach, Hirschberg, Holzappel, Holzheim, Horhausen, Isselbach, Langenscheid, Laurenburg, Scheidt, Steinsberg, Wasenbach |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Nastätten |
|
|
|
|
die Gemeinden
Berg, Bettendorf, Bogel, Buch, Diethardt, Ehr, Endlichhofen, Eschbach, Gemmerich, Hainau, Himmighofen, Holzhausen an der Haide, Hunzel, Kasdorf, Kehlbach, Lautert, Lipporn, Marienfels, Miehlen, Nastätten, Niederbachheim, Niederwallmenach, Oberbachheim, Obertiefenbach, Oberwallmenach, Oelsberg, Rettershain, Ruppertshofen, Strüth, Weidenbach, Welterod, Winterwerb |
|
|
|
|
von der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Attenhausen, Dessighofen, Dienethal, Dornholzhausen, Geisig, Hömberg, Lollschied, Misselberg, Nassau, Obernhof, Oberwies, Pohl, Schweighausen, Seelbach, Singhofen, Sulzbach, Weinähr, Winden, Zimmerschied |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 199) |
|
205
|
Mainz |
Kreisfreie Stadt Mainz |
|
|
|
vom Landkreis Mainz-Bingen |
|
|
|
|
verbandsfreie Gemeinden
Bingen am Rhein, Budenheim, Ingelheim am Rhein |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Gau-Algesheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Appenheim, Bubenheim, Engelstadt, Gau-Algesheim, Nieder-Hilbersheim, Ober-Hilbersheim, Ockenheim, Schwabenheim an der Selz |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Nieder-Olm |
|
|
|
|
die Gemeinden
Essenheim, Jugenheim in Rheinhessen, Klein-Winternheim, Nieder-Olm, Ober-Olm, Sörgenloch, Stadecken-Elsheim, Zornheim |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Rhein-Nahe |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bacharach, Breitscheid, Manubach, Münster-Sarmsheim, Niederheimbach, Oberdiebach, Oberheimbach, Trechtingshausen, Waldalgesheim, Weiler bei Bingen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 206) |
|
206
|
Worms |
Kreisfreie Stadt Worms |
|
|
|
Landkreis Alzey-Worms |
|
|
|
vom Landkreis Mainz-Bingen |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Bodenheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bodenheim, Gau-Bischofsheim, Harxheim, Lörzweiler, Nackenheim |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Rhein-Selz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dalheim, Dexheim, Dienheim, Dolgesheim, Dorn-Dürkheim, Eimsheim, Friesenheim, Guntersblum, Hahnheim, Hillesheim, Köngernheim, Ludwigshöhe, Mommenheim, Nierstein, Oppenheim, Selzen, Uelversheim, Undenheim, Weinolsheim, Wintersheim |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aspisheim, Badenheim, Gensingen, Grolsheim, Horrweiler, Sankt Johann, Sprendlingen, Welgesheim, Wolfsheim, Zotzenheim |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 205) |
|
207
|
Ludwigshafen/Frankenthal |
Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz) |
|
|
|
Kreisfreie Stadt Ludwigshafen am Rhein |
|
|
|
vom Rhein-Pfalz-Kreis |
|
|
|
|
verbandsfreie Gemeinden
Bobenheim-Roxheim, Böhl-Iggelheim, Limburgerhof, Mutterstadt |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-Gronau |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Beindersheim, Großniedesheim, Heßheim, Heuchelheim bei Frankenthal, Kleinniedesheim, Lambsheim |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Maxdorf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Birkenheide, Fußgönheim, Maxdorf |
|
|
|
|
von der Verbandsgemeinde Rheinauen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altrip, Neuhofen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 208) |
|
208
|
Neustadt – Speyer |
Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße |
|
|
|
Kreisfreie Stadt Speyer |
|
|
|
Landkreis Bad Dürkheim |
|
|
|
vom Rhein-Pfalz-Kreis |
|
|
|
|
verbandsfreie Gemeinde Schifferstadt |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dudenhofen, Hanhofen, Harthausen, Römerberg |
|
|
|
|
von der Verbandsgemeinde Rheinauen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Otterstadt, Waldsee |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 207) |
|
209
|
Kaiserslautern |
Kreisfreie Stadt Kaiserslautern |
|
|
|
Donnersbergkreis |
|
|
|
Landkreis Kusel |
|
|
|
vom Landkreis Kaiserslautern |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn |
|
|
|
|
die Gemeinden
Enkenbach-Alsenborn, Fischbach, Frankenstein, Hochspeyer, Mehlingen, Neuhemsbach, Sembach, Waldleiningen |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Frankelbach, Heiligenmoschel, Hirschhorn/Pfalz, Katzweiler, Mehlbach, Niederkirchen, Olsbrücken, Otterbach, Otterberg, Schallodenbach, Schneckenhausen, Sulzbachtal |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Weilerbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Erzenhausen, Eulenbis, Kollweiler, Mackenbach, Reichenbach-Steegen, Rodenbach, Schwedelbach, Weilerbach |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 210) |
|
210
|
Pirmasens |
Kreisfreie Stadt Pirmasens |
|
|
|
Kreisfreie Stadt Zweibrücken |
|
|
|
Landkreis Südwestpfalz |
|
|
|
vom Landkreis Kaiserslautern |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bruchmühlbach-Miesau, Gerhardsbrunn, Lambsborn, Langwieden, Martinshöhe |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Landstuhl |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, Landstuhl, Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, Trippstadt |
|
|
|
|
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hütschenhausen, Kottweiler-Schwanden, Niedermohr, Ramstein-Miesenbach, Steinwenden |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 209) |
|
211
|
Südpfalz |
Kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz |
|
|
|
Landkreis Germersheim |
|
|
|
Landkreis Südliche Weinstraße |
|
Bayern
|
|
212
|
Altötting |
Landkreis Altötting |
|
|
|
Landkreis Mühldorf a. Inn |
|
213
|
Erding – Ebersberg |
Landkreis Ebersberg |
|
|
|
Landkreis Erding |
|
214
|
Freising |
Landkreis Freising |
|
|
|
Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm |
|
|
|
vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aresing, Schrobenhausen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Berg im Gau, Brunnen, Gachenbach, Langenmosen, Waidhofen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 216) |
|
215
|
Fürstenfeldbruck |
Landkreis Dachau |
|
|
|
vom Landkreis Fürstenfeldbruck |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alling, Egenhofen, Eichenau, Emmering, Fürstenfeldbruck, Gröbenzell, Maisach, Moorenweis, Olching, Puchheim, Türkenfeld |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Grafrath |
|
|
|
|
die Gemeinden
Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Adelshofen, Althegnenberg, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschweinbach |
|
|
|
(Übrige Gemeinde s. Wkr. 224) |
|
216
|
Ingolstadt |
Kreisfreie Stadt Ingolstadt |
|
|
|
Landkreis Eichstätt |
|
|
|
vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Burgheim, Ehekirchen, Karlshuld, Karlskron, Königsmoos, Neuburg a. d. Donau, Oberhausen, Rennertshofen, Weichering |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a. d. Donau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bergheim, Rohrenfels |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 214) |
|
217
|
München-Nord |
Von der kreisfreien Stadt München |
|
|
|
|
die Stadtbezirke 3, 4, 10 bis 12, 24 |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 218, 219, 220) |
|
218
|
München-Ost |
Von der kreisfreien Stadt München |
|
|
|
|
die Stadtbezirke 1, 5, 13 bis 16 |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 217, 219, 220) |
|
219
|
München-Süd |
Von der kreisfreien Stadt München |
|
|
|
|
die Stadtbezirke 6, 7, 17 bis 20 |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 217, 218, 220) |
|
220
|
München-West/Mitte |
Von der kreisfreien Stadt München |
|
|
|
|
die Stadtbezirke 2, 8, 9, 21 bis 23, 25 |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 217, 218, 219) |
|
221
|
München-Land |
Landkreis München |
|
222
|
Rosenheim |
Kreisfreie Stadt Rosenheim |
|
|
|
Landkreis Rosenheim |
|
223
|
Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
|
|
|
Landkreis Miesbach |
|
224
|
Starnberg – Landsberg am Lech |
Landkreis Landsberg am Lech |
|
|
|
Landkreis Starnberg |
|
|
|
vom Landkreis Fürstenfeldbruck |
|
|
|
|
die Gemeinde Germering |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 215) |
|
225
|
Traunstein |
Landkreis Berchtesgadener Land |
|
|
|
Landkreis Traunstein |
|
226
|
Weilheim |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen |
|
|
|
Landkreis Weilheim-Schongau |
|
227
|
Deggendorf |
Landkreis Deggendorf |
|
|
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
|
|
|
vom Landkreis Passau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aicha vorm Wald, Eging a.See, Fürstenstein, Hofkirchen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 229) |
|
228
|
Landshut |
Kreisfreie Stadt Landshut |
|
|
|
Landkreis Kelheim |
|
|
|
vom Landkreis Landshut |
|
|
|
|
die Gemeinden
Adlkofen, Altdorf, Bodenkirchen, Bruckberg, Buch a.Erlbach, Eching, Ergolding, Essenbach, Geisenhausen, Hohenthann, Kumhausen, Neufahrn i.NB, Niederaichbach, Pfeffenhausen, Rottenburg a. d. Laaber, Tiefenbach, Vilsbiburg, Vilsheim |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altfraunhofen, Baierbach |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Ergoldsbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bayerbach b.Ergoldsbach, Ergoldsbach |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Furth |
|
|
|
|
die Gemeinden
Furth, Obersüßbach, Weihmichl |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Velden |
|
|
|
|
die Gemeinden
Neufraunhofen, Velden, Wurmsham |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 230) |
|
229
|
Passau |
Kreisfreie Stadt Passau |
|
|
|
vom Landkreis Passau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aldersbach, Bad Füssing, Bad Griesbach i.Rottal, Breitenberg, Büchlberg, Fürstenzell, Haarbach, Hauzenberg, Hutthurm, Kirchham, Kößlarn, Neuburg a. Inn, Neuhaus a. Inn, Neukirchen vorm Wald, Obernzell, Ortenburg, Pocking, Ruderting, Ruhstorf a. d. Rott, Salzweg, Sonnen, Tettenweis, Thyrnau, Tiefenbach, Untergriesbach, Vilshofen an der Donau, Wegscheid, Windorf |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Aidenbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aidenbach, Beutelsbach |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Rotthalmünster |
|
|
|
|
die Gemeinden
Malching, Rotthalmünster |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Tittling |
|
|
|
|
die Gemeinden
Tittling, Witzmannsberg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 227) |
|
230
|
Rottal-Inn |
Landkreis Dingolfing-Landau |
|
|
|
Landkreis Rottal-Inn |
|
|
|
vom Landkreis Landshut |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Gerzen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aham, Gerzen, Kröning, Schalkham |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a. d. Isar |
|
|
|
|
die Gemeinden
Postau, Weng, Wörth a. d. Isar |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 228) |
|
231
|
Straubing |
Kreisfreie Stadt Straubing |
|
|
|
Landkreis Regen |
|
|
|
Landkreis Straubing-Bogen |
|
232
|
Amberg |
Kreisfreie Stadt Amberg |
|
|
|
Landkreis Amberg-Sulzbach |
|
|
|
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. |
|
233
|
Regensburg |
Kreisfreie Stadt Regensburg |
|
|
|
vom Landkreis Regensburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Barbing, Beratzhausen, Bernhardswald, Hagelstadt, Hemau, Köfering, Lappersdorf, Mintraching, Neutraubling, Nittendorf, Obertraubling, Pentling, Pettendorf, Pfatter, Regenstauf, Schierling, Sinzing, Tegernheim, Thalmassing, Wenzenbach, Wiesent, Zeitlarn |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alteglofsheim, Pfakofen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Donaustauf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altenthann, Bach a. d. Donau, Donaustauf |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Duggendorf, Holzheim a.Forst, Kallmünz |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Laaber |
|
|
|
|
die Gemeinden
Brunn, Deuerling, Laaber |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Pielenhofen, Wolfsegg |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Sünching |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aufhausen, Mötzing, Riekofen, Sünching |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 234) |
|
234
|
Schwandorf |
Landkreis Cham |
|
|
|
Landkreis Schwandorf |
|
|
|
vom Landkreis Regensburg |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a. d. Donau |
|
|
|
|
die Gemeinden
Brennberg, Wörth a. d. Donau |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 233) |
|
235
|
Weiden |
Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf. |
|
|
|
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab |
|
|
|
Landkreis Tirschenreuth |
|
236
|
Bamberg |
Kreisfreie Stadt Bamberg |
|
|
|
vom Landkreis Bamberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altendorf, Buttenheim, Frensdorf, Hallstadt, Hirschaid, Pettstadt, Pommersfelden, Schlüsselfeld, Stegaurach, Strullendorf, Walsdorf |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Burgebrach, Schönbrunn i.Steigerwald |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Ebrach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Burgwindheim, Ebrach |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Lisberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Lisberg, Priesendorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 240) |
|
|
|
vom Landkreis Forchheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Eggolsheim, Forchheim, Hallerndorf, Hausen, Heroldsbach, Igensdorf, Langensendelbach, Neunkirchen a.Brand |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Dormitz |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dormitz, Hetzles, Kleinsendelbach |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich |
|
|
|
|
die Gemeinden
Effeltrich, Poxdorf |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Gosberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Kunreuth, Pinzberg, Wiesenthau |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Kirchehrenbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Kirchehrenbach, Leutenbach, Weilersbach |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 237) |
|
237
|
Bayreuth |
Kreisfreie Stadt Bayreuth |
|
|
|
Landkreis Bayreuth |
|
|
|
vom Landkreis Forchheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Egloffstein, Gößweinstein, Obertrubach, Pretzfeld, Wiesenttal |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ebermannstadt, Unterleinleiter |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Gräfenberg, Hiltpoltstein, Weißenohe |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 236) |
|
238
|
Coburg |
Kreisfreie Stadt Coburg |
|
|
|
Landkreis Coburg |
|
|
|
Landkreis Kronach |
|
|
|
vom Landkreis Hof |
|
|
|
|
die Gemeinde Geroldsgrün |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 239) |
|
239
|
Hof |
Kreisfreie Stadt Hof |
|
|
|
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge |
|
|
|
vom Landkreis Hof |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Steben, Berg, Döhlau, Helmbrechts, Köditz, Konradsreuth, Münchberg, Naila, Oberkotzau, Regnitzlosau, Rehau, Schwarzenbach a. Wald, Schwarzenbach a. d. Saale, Selbitz, Stammbach, Zell im Fichtelgebirge |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Feilitzsch |
|
|
|
|
die Gemeinden
Feilitzsch, Gattendorf, Töpen, Trogen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Lichtenberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Issigau, Lichtenberg |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Schauenstein |
|
|
|
|
die Gemeinden
Leupoldsgrün, Schauenstein |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Sparneck |
|
|
|
|
die Gemeinden
Sparneck, Weißdorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinde s. Wkr. 238) |
|
240
|
Kulmbach |
Landkreis Kulmbach |
|
|
|
Landkreis Lichtenfels |
|
|
|
vom Landkreis Bamberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bischberg, Breitengüßbach, Gundelsheim, Heiligenstadt i.OFr., Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Rattelsdorf, Scheßlitz, Viereth-Trunstadt, Zapfendorf |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Baunach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Baunach, Gerach, Lauter, Reckendorf |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld |
|
|
|
|
die Gemeinden
Königsfeld, Stadelhofen, Wattendorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 236) |
|
241
|
Ansbach |
Kreisfreie Stadt Ansbach |
|
|
|
Landkreis Ansbach |
|
|
|
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen |
|
242
|
Erlangen |
Kreisfreie Stadt Erlangen |
|
|
|
Landkreis Erlangen-Höchstadt |
|
|
|
vom Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dachsbach, Gerhardshofen, Uehlfeld |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 243) |
|
243
|
Fürth |
Kreisfreie Stadt Fürth |
|
|
|
Landkreis Fürth |
|
|
|
vom Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Windsheim, Burghaslach, Dietersheim, Emskirchen, Ipsheim, Markt Erlbach, Neustadt a. d. Aisch, Obernzenn |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Burgbernheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Burgbernheim, Gallmersgarten, Illesheim, Marktbergel |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Diespeck |
|
|
|
|
die Gemeinden
Baudenbach, Diespeck, Gutenstetten, Münchsteinach |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Hagenbüchach-Wilhelmsdorf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hagenbüchach, Wilhelmsdorf |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Neuhof a. d. Zenn |
|
|
|
|
die Gemeinden
Neuhof a. d. Zenn, Trautskirchen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Scheinfeld |
|
|
|
|
die Gemeinden
Langenfeld, Markt Bibart, Markt Taschendorf, Oberscheinfeld, Scheinfeld, Sugenheim |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ergersheim, Gollhofen, Hemmersheim, Ippesheim, Markt Nordheim, Oberickelsheim, Simmershofen, Uffenheim, Weigenheim |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 242) |
|
244
|
Nürnberg-Nord |
Von der kreisfreien Stadt Nürnberg |
|
|
|
|
die Bezirke
01 bis 13, 22 bis 30, 64, 65, 70 bis 87, 90 bis 95 |
|
|
|
(Übrige Bezirke s. Wkr. 245) |
|
245
|
Nürnberg-Süd |
Kreisfreie Stadt Schwabach |
|
|
|
von der kreisfreien Stadt Nürnberg |
|
|
|
|
die Bezirke
14 bis 21, 31 bis 55, 60 bis 63, 96, 97 |
|
|
|
(Übrige Bezirke s. Wkr. 244) |
|
246
|
Roth |
Landkreis Nürnberger Land |
|
|
|
Landkreis Roth |
|
247
|
Aschaffenburg |
Kreisfreie Stadt Aschaffenburg |
|
|
|
Landkreis Aschaffenburg |
|
248
|
Bad Kissingen |
Landkreis Bad Kissingen |
|
|
|
Landkreis Haßberge |
|
|
|
Landkreis Rhön-Grabfeld |
|
249
|
Main-Spessart |
Landkreis Main-Spessart |
|
|
|
Landkreis Miltenberg |
|
250
|
Schweinfurt |
Kreisfreie Stadt Schweinfurt |
|
|
|
Landkreis Kitzingen |
|
|
|
Landkreis Schweinfurt |
|
251
|
Würzburg |
Kreisfreie Stadt Würzburg |
|
|
|
Landkreis Würzburg |
|
252
|
Augsburg-Stadt |
Kreisfreie Stadt Augsburg |
|
|
|
vom Landkreis Augsburg |
|
|
|
|
die Gemeinde Königsbrunn |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 253, 254) |
|
253
|
Augsburg-Land |
Vom Landkreis Aichach-Friedberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Affing, Aichach, Friedberg, Hollenbach, Kissing, Merching, Rehling, Ried |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Dasing |
|
|
|
|
die Gemeinden
Adelzhausen, Dasing, Eurasburg, Obergriesbach, Sielenbach |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Mering |
|
|
|
|
die Gemeinden
Mering, Schmiechen, Steindorf |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 254) |
|
|
|
vom Landkreis Augsburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Adelsried, Aystetten, Biberbach, Bobingen, Diedorf, Dinkelscherben, Fischach, Gablingen, Gersthofen, Graben, Horgau, Kutzenhausen, Langweid a.Lech, Meitingen, Neusäß, Schwabmünchen, Stadtbergen, Thierhaupten, Wehringen, Zusmarshausen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Gessertshausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Gessertshausen, Ustersbach |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Großaitingen, Kleinaitingen, Oberottmarshausen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Langerringen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Hiltenfingen, Langerringen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld |
|
|
|
|
die Gemeinden
Klosterlechfeld, Untermeitingen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf |
|
|
|
|
die Gemeinden
Allmannshofen, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, Nordendorf, Westendorf |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Stauden |
|
|
|
|
die Gemeinden
Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten, Walkertshofen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Welden |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bonstetten, Emersacker, Heretsried, Welden |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 252, 254) |
|
254
|
Donau-Ries |
Landkreis Dillingen a. d. Donau |
|
|
|
Landkreis Donau-Ries |
|
|
|
vom Landkreis Aichach-Friedberg |
|
|
|
|
die Gemeinde Inchenhofen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Aindling |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aindling, Petersdorf, Todtenweis |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Kühbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Kühbach, Schiltberg |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes |
|
|
|
|
die Gemeinden
Baar (Schwaben), Pöttmes |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 253) |
|
|
|
vom Landkreis Augsburg |
|
|
|
|
die Gemeinde Altenmünster |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 252, 253) |
|
255
|
Neu-Ulm |
Landkreis Günzburg |
|
|
|
Landkreis Neu-Ulm |
|
|
|
vom Landkreis Unterallgäu |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Babenhausen, Egg a. d. Günz, Kettershausen, Kirchhaslach, Oberschönegg, Winterrieden |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Boos |
|
|
|
|
die Gemeinden
Boos, Fellheim, Heimertingen, Niederrieden, Pleß |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Erkheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Erkheim, Kammlach, Lauben, Westerheim |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Breitenbrunn, Oberrieden, Pfaffenhausen, Salgen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 257) |
|
256
|
Oberallgäu |
Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) |
|
|
|
Landkreis Lindau (Bodensee) |
|
|
|
Landkreis Oberallgäu |
|
257
|
Ostallgäu |
Kreisfreie Stadt Kaufbeuren |
|
|
|
Kreisfreie Stadt Memmingen |
|
|
|
Landkreis Ostallgäu |
|
|
|
vom Landkreis Unterallgäu |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Wörishofen, Buxheim, Ettringen, Markt Rettenbach, Markt Wald, Mindelheim, Sontheim, Tussenhausen und das gemeindefreie Gebiet Ungerhauser Wald |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Grönenbach, Wolfertschwenden, Woringen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang |
|
|
|
|
die Gemeinden
Apfeltrach, Dirlewang, Stetten, Unteregg |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel |
|
|
|
|
die Gemeinden
Kronburg, Lautrach, Legau |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim i. Schw. |
|
|
|
|
die Gemeinden
Eppishausen, Kirchheim i. Schw. |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Benningen, Holzgünz, Lachen, Memmingerberg, Trunkelsberg, Ungerhausen |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren |
|
|
|
|
die Gemeinden
Böhen, Hawangen, Ottobeuren |
|
|
|
|
Verwaltungsgemeinschaft Türkheim |
|
|
|
|
die Gemeinden
Amberg, Rammingen, Türkheim, Wiedergeltingen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 255) |
|
Baden-Württemberg
|
|
258
|
Stuttgart I |
Vom Stadtkreis Stuttgart |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
Birkach, Degerloch, Hedelfingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 259) |
|
259
|
Stuttgart II |
Vom Stadtkreis Stuttgart |
|
|
|
|
die Stadtbezirke
Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen |
|
|
|
(Übrige Stadtbezirke s. Wkr. 258) |
|
260
|
Böblingen |
Vom Landkreis Böblingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der Stadt, Weil im Schönbuch |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 262, 265) |
|
261
|
Esslingen |
Vom Landkreis Esslingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, Plochingen, Reichenbach an der Fils, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar) |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 262) |
|
262
|
Nürtingen |
Vom Landkreis Böblingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Steinenbronn, Waldenbuch |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 260, 265) |
|
|
|
vom Landkreis Esslingen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensingen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 261) |
|
263
|
Göppingen |
Landkreis Göppingen |
|
264
|
Waiblingen |
Vom Rems-Murr-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, Leutenbach, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnenden, Winterbach |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 269) |
|
265
|
Ludwigsburg |
Vom Landkreis Böblingen |
|
|
|
|
die Gemeinde Weissach |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 260, 262) |
|
|
|
vom Landkreis Ludwigsburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, Remseck am Neckar, Schwieberdingen, Sersheim, Vaihingen an der Enz |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 266) |
|
266
|
Neckar-Zaber |
Vom Landkreis Heilbronn |
|
|
|
|
die Gemeinden
Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, Untergruppenbach, Zaberfeld |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 267) |
|
|
|
vom Landkreis Ludwigsburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 265) |
|
267
|
Heilbronn |
Stadtkreis Heilbronn |
|
|
|
vom Landkreis Heilbronn |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg, Widdern, Wüstenrot |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 266) |
|
268
|
Schwäbisch Hall – Hohenlohe |
Hohenlohekreis |
|
|
|
Landkreis Schwäbisch Hall |
|
269
|
Backnang – Schwäbisch Gmünd |
Vom Ostalbkreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Abtsgmünd, Bartholomä, Böbingen an der Rems, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 270) |
|
|
|
vom Rems-Murr-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, Großerlach, Kirchberg an der Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 264) |
|
270
|
Aalen – Heidenheim |
Landkreis Heidenheim |
|
|
|
vom Ostalbkreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aalen, Adelmannsfelden, Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Essingen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 269) |
|
271
|
Karlsruhe-Stadt |
Stadtkreis Karlsruhe |
|
272
|
Karlsruhe-Land |
Vom Landkreis Karlsruhe |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondelsheim, Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walzbachtal, Weingarten (Baden), Zaisenhausen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 278) |
|
273
|
Rastatt |
Stadtkreis Baden-Baden |
|
|
|
Landkreis Rastatt |
|
274
|
Heidelberg |
Stadtkreis Heidelberg |
|
|
|
vom Rhein-Neckar-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg an der Bergstraße, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, Weinheim |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 277, 278) |
|
275
|
Mannheim |
Stadtkreis Mannheim |
|
276
|
Odenwald – Tauber |
Main-Tauber-Kreis |
|
|
|
Neckar-Odenwald-Kreis |
|
277
|
Rhein-Neckar |
Vom Rhein-Neckar-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Angelbachtal, Bammental, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, Rauenberg, Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzenhausen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 274, 278) |
|
278
|
Bruchsal – Schwetzingen |
Vom Landkreis Karlsruhe |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 272) |
|
|
|
vom Rhein-Neckar-Kreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 274, 277) |
|
279
|
Pforzheim |
Stadtkreis Pforzheim |
|
|
|
Enzkreis |
|
280
|
Calw |
Landkreis Calw |
|
|
|
Landkreis Freudenstadt |
|
281
|
Freiburg |
Stadtkreis Freiburg im Breisgau |
|
|
|
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald |
|
|
|
|
die Gemeinden
Au, Bötzingen, Bollschweil, Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, Horben, Ihringen, March, Merdingen, Merzhausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 282, 288) |
|
282
|
Lörrach – Müllheim |
Landkreis Lörrach |
|
|
|
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald |
|
|
|
|
die Gemeinden
Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Eschbach, Hartheim am Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, Sulzburg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 281, 288) |
|
283
|
Emmendingen – Lahr |
Landkreis Emmendingen |
|
|
|
vom Ortenaukreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Ettenheim, Fischerbach, Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, Mühlenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, Schwanau, Seelbach, Steinach |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 284, 286) |
|
284
|
Offenburg |
Vom Ortenaukreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, Durbach, Gengenbach, Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell am Harmersbach |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 283, 286) |
|
285
|
Rottweil – Tuttlingen |
Landkreis Rottweil |
|
|
|
Landkreis Tuttlingen |
|
286
|
Schwarzwald-Baar |
Schwarzwald-Baar-Kreis |
|
|
|
vom Ortenaukreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Gutach (Schwarzwaldbahn), Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 283, 284) |
|
287
|
Konstanz |
Landkreis Konstanz |
|
288
|
Waldshut |
Landkreis Waldshut |
|
|
|
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald |
|
|
|
|
die Gemeinden
Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarzwald), Friedenweiler, Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 281, 282) |
|
289
|
Reutlingen |
Landkreis Reutlingen |
|
290
|
Tübingen |
Landkreis Tübingen |
|
|
|
vom Zollernalbkreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bisingen, Burladingen, Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, Rangendingen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 295) |
|
291
|
Ulm |
Stadtkreis Ulm |
|
|
|
Alb-Donau-Kreis |
|
292
|
Biberach |
Landkreis Biberach |
|
|
|
vom Landkreis Ravensburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Aichstetten, Aitrach, Bad Wurzach, Kißlegg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 294) |
|
293
|
Bodensee |
Bodenseekreis |
|
|
|
vom Landkreis Sigmaringen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Herdwangen-Schönach, Illmensee, Pfullendorf, Wald |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 295) |
|
294
|
Ravensburg |
Vom Landkreis Ravensburg |
|
|
|
|
die Gemeinden
Achberg, Altshausen, Amtzell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 292) |
|
295
|
Zollernalb – Sigmaringen |
Vom Landkreis Sigmaringen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bad Saulgau, Beuron, Bingen, Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, Hohentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Veringenstadt |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 293) |
|
|
|
vom Zollernalbkreis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen, Haigerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Weilen unter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 290) |
|
Saarland
|
|
296
|
Saarbrücken |
Vom Regionalverband Saarbrücken |
|
|
|
|
die Gemeinden
Großrosseln, Kleinblittersdorf, Püttlingen, Riegelsberg, Saarbrücken, Völklingen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 298, 299) |
|
297
|
Saarlouis |
Landkreis Merzig-Wadern |
|
|
|
vom Landkreis Saarlouis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Bous, Dillingen/Saar, Ensdorf, Nalbach, Rehlingen-Siersburg, Saarlouis, Saarwellingen, Schwalbach, Überherrn, Wadgassen, Wallerfangen |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 298) |
|
298
|
St. Wendel |
Landkreis St. Wendel |
|
|
|
vom Landkreis Neunkirchen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Eppelborn, Illingen, Merchweiler, Ottweiler, Schiffweiler |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 299) |
|
|
|
vom Landkreis Saarlouis |
|
|
|
|
die Gemeinden
Lebach, Schmelz |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 297) |
|
|
|
vom Regionalverband Saarbrücken |
|
|
|
|
die Gemeinde Heusweiler |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 296, 299) |
|
299
|
Homburg |
Saarpfalz-Kreis |
|
|
|
vom Landkreis Neunkirchen |
|
|
|
|
die Gemeinden
Neunkirchen, Spiesen-Elversberg |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 298) |
|
|
|
vom Regionalverband Saarbrücken |
|
|
|
|
die Gemeinden
Friedrichsthal, Quierschied, Sulzbach/Saar |
|
|
|
(Übrige Gemeinden s. Wkr. 296, 298). |
Sowie gegen:
- Tina Dressel – Stadtverwaltung Gera
- Anette Beckers – Burggemeinde Brüggen
- Herrn Ort/ Landrat Klimpel – Kreis Recklinghausen
- Herrn Ballat – Stadt Paderborn
- Herrn Schuster/Sven Strauß – Stadt Sangerhausen
- Frau Topp – Stadt Olpen in Sachsen
- Herrn Obst (Landrat) – Landkreis Sächsische Schweiz- Osterzgebirge
- Marc Rostohar – Stadt Dortmund
- Herr Elpers/Dehker – Kreisstadt Steinfurth
- Lena Heimes/ Dr. Gdenen – Kreis Viersen
- Herrn Hartmut Heck – Verbandsgemeinde Hermeskeil
- Den Bundeswahlleiter – Statistisches Bundesamt Wiesbaden
- gegen alle Wahlteilnehmer sogenannte „Wahlberechtigte“
- weitere Personen nicht ausgeschlossen….
Begründung:
Laut offiziellen Medien soll es zur 20. Bundeswahl am heutigen Tage, den 26.09.2021 ca. 60 Millionen Wahlberechtigte geben.
Diese Zahl ist absolut unzutreffend, dass das Bundesverwaltungsamt (BVA) in Köln im Sammelregister (ESTA) derzeit nachweislich nur ca. 4,88 Millionen Deutsche kennt und führt, wobei auch die festgestellten im Ausland lebenden Deutschen bei jener Zahl eingebunden sind.
Dies allein wirft schon eine gewaltige Frage bezüglich der Summer der angeblichen Wahlberechtigten von ca. 60 Millionen auf!
So kann der Unterzeichner nach langer Vorbereitung und zusammentragen vieler Beweise klar beweisen, dass nicht nur er, dessen Ehefrau, Sohn, Bruder und alle seiner Freunde und Bekannten in den jeweiligen Wählerlisten als „Wahlberechtigte“ eingetragen wurden, obwohl sie allesamt nachweislich nicht die Wahlrechtsvoraussetzungen erfüllen.
Dieser Zustand trifft nach langen Ermittlungen auf alle sogenannten „Wahlberechtigen“ zu!
Will heißen keine einzige Person erfüllt nachweislich den Status als Deutscher nach Art. 116 Abs. 1 GG (Deutsche mit deutscher Staatsangehörigkeit oder Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit (Statusdeutsche)), weder zum aktuellen Zeitpunkt also dem Tag der Wahl als auch zum Zeitpunkt der Aufnahme in die jeweiligen Wählerlisten.
Dieser Umstände sind folgenden Tatsachen geschuldet:
Über 95% der hier lebenden Einwohner haben noch nie einen Verwaltungsakt zur rechtlich verbindlichen Klärung ihrer Staatsangehörigkeit beantragt noch durchlaufen. Dabei ist festzuhalten, dass rechtlich und sachlich ausschließlich nur die wohnortzuständigen Staatsangehörigkeitsbehörden für die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit zuständig sind. Und nur im Wege eines Verwaltungsaktes „Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit“ rechtsverbindlich festgestellt werden kann und darf. Heist keine andere Behörde ist rechtlich und sachlich berechtigt, das staatsangehörigkeitsrechtliche Rechtsverhältnis einer Person welche ihre Niederlassung in Deutschland zu bestimmen, so auch nicht die betroffene Person selbst, als auch nicht außerhalb des Verwaltungsaktes „Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.
Dennoch werden die Menschen in Deutschland systematisch durch vor Allem die Einwohnermeldebehörden durch Täuschung genötigt, ihren Status als Deutschen nach Art. 116 Abs.1 GG selbst zu bestimmen, und das obwohl in der Fach- und Rechtsliteratur deutlich zu lesen ist, dass in Staatsangehörigkeitsrechtlichen Dingen vom Betroffenen keine Sachkenntnisse zu erwarten sind.
Dies liegt daran, dass fast alle Menschen in Deutschland weder das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht seit 1870 mit all seinen Änderungen bis heute kennen. Sie kennen nicht alle Verlustgründe durch politische Ereignisse, z.B. Versailler Vertrag, Wiener Abkommen, Genfer Abkommen, Entziehung aus politisch, rassischen oder religiösen Gründen im 3. Reich usw..
So wissen die Meisten nicht mal, dass Geburtsort und Wohnsitz für das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht, wenn deren Eltern nicht nachweislich Ausländer sind, eingeführt zum 01.01.2000 unerheblich sind.
Sie wissen nicht, dass der Anknüpfungszeitpunkt seines Angehörigensubstrates sich immer beim Abstammunsgprinzip §4 abs.1 (Ru)StaG auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens jener gesetzlichen Regelung bezieht und dies nun mal der 01. Januar 1914 ist.
So kommt ein weiterer wesentlicher Umstand hinzu. Die meisten Menschen kennen nicht mal ihre Vorfahren bis zu diesem Zeitpunkt, schon gar nicht deren Rechtsverhältnisse und das dessen Rechtsverhältnisse und Ereignisse auf den Status als Deutschen nach Art. 116 Abs.1 GG (Deutsche mit oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit (Statusdeutsche) direkt auf den Betroffenen haben.
Dennoch nimmt man diese Angaben der Betroffenen in die Datensätze der Einwohnermeldebehörden auf. Dies wurde durch div. Schreiben verschiedener Einwohnermelden bestätigt
In vielen, wenn nicht sogar meisten Fällen maßt sich ein(e) Mitarbeiter(in) der Einwohnermeldebehörde an, das Rechtsverhältnis eigenmächtig und ohne jegliche Nachweise zur vorstelligen Person zu bestimmen. Und er oder sie ist es die diesen Rechtszustand mit Staatsangehörigkeit „deutsch“ bestimmt und selbst in den Datensatz einpflegt. Lediglich wird die ahnungslose vorstellige Person dazu gebracht, diesen Eintrag mit seiner eigenen Unterschrift zu bestätigen und somit für die „Richtigkeit“ die Haftung übernimmt.
Dasselbe Spiel wiederholt sich zu jedweiiger Beantragung von deutschem Personalausweis und deutschem Reisepass. Auch hier soll die antragstellende Person sein Rechtsverhältnis trotz nachweislicher Unkenntnis und fehlender rechtlicher und sachlicher Kompetenz selbst bestimmen. Oder es wird durch den/die Sacharbeiter(in) wieder eigenmächtig ohne jegliche Nachweise bestimmt und die betroffene Person dazu getäuscht, wieder durch Unterschrift die unrichtigen und widerrechtlichen Eintragungen zu unterschreiben und wieder die Haftung für jene Einträge zu nehmen.
Besonders zu beachten sind hierbei Verstöße gegen § 6 Abs. 2 Satz und ganz besonders Satz 2 sowie § 9 Abs.1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 und Satz 3 Personalausweisgesetz zu beachten, denn hier steht unmissverständlich, dass die Antragstellende Person die Nachweise der Deutscheigenschaften zu erbringen hat.
Der Unterzeichner kann beweisen, dass weder zu ihm, seiner Frau, Sohn, Bruder, Freunden und Verwandten sowie zu keiner Person jemals diese gesetzlich vorgeschriebenen Nachweise je gefordert noch erbracht wurden.
Es lässt sich leicht beweisen, dass sowohl das Erstdokument als auch alle Folgedokumente unter Verletzungen jener Rechtsvorschriften somit widerrechtlich erworben wurden.
Auf diese widerrechtlichen Erwerbungen deutscher Dokumente sowie die widerrechtlichen Selbstbestimmungen (Angaben des Betroffenen) soll nun die Legitimität zu Bundestags- Landtags- oder sonstigen Wahlen begründet werden.
Dies ist nicht nur ungeheuerlich, sondern schlicht kriminell!
Es ist dem Unterzeichner ein leichtes nachzuweisen, dass alle „Wahlberechtigen“ zu über 95% aus Status „Ungeklärt“, aus festgestellten Deutschen ohne Aktualisierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt und aus Staatenlosen durch unzählige Ablehnungsbescheiden des Verwaltungsaktes „Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit“ mit der Rechtsfolge der Ablehnung der Feststellung entsprechend dem TESO-Urteil 137 Abs. 22 Satz bestehen.
Der Unterzeichner kann ebenfalls beweisen, dass eine Überprüfung der Wahlrechtsvoraussetzung nämlich Deutsche(r) am Tag der Aufnahme in das Wählerverzeichnis in ganz Deutschland systematisch unterblieben ist, somit für die angebliche Richtigkeit der Wählerverzeichnisse nicht garantiert werden kann, um einen Missbrauch unterbinden zu können, wobei der Missbrauch durch Aufnahme von Nichtwahlberechtigten auf der Hand liegt. Und das nicht nur im Einzelfall zum Unterzeichner, dessen Familie, Freunde und Verwandte, sondern zu allen „Wahlberechtigten“.
Hierzu hatten der Unterzeichner und eine Gruppe von an angeblich alle „Wahlberechtigten“ ihr Recht in Anspruch genommen, Einsicht der zu ihrer Person gespeicherten Daten im Wählerverzeichnis zu nehmen.
Diese Aktion erstreckte sich von Totalverweigerungen bis hin zur Einsichtnahme und Ausdrucken. Jedoch das Gesamtbild, was sich hierbei bot war und ist haarsträubend! So befanden sich zum Unterzeichner in dessen Datensatz nur Passbild und der Name. In anderen Fällen stand Staatsangehörigkeit „deutsch“ obwohl bis heute auf viele schriftl. Anfragen bei Einwohnermeldebehörden, Standesämtern, Deutschen Bundestag, Bundesministerium des Inneren, Landesregierung, Innenministerien der Länder usw… niemand in der Lage und Willens war, die Frage nach dem Namen des Gesetztes, den §§ und den Gesetzestext zu erbringen, worin der Gesetzgeber angeblich den Begriff Staatsangehörigkeit „deutsch/DEUTSCH“ rechtverbindlich als gegeben definiert hat und was er darunter versteht bzw. den rechtlichen Rahmen bestimmt hat.
Aber es wird ja noch absurder. Bei einigen befand sich ein Eintrag: Staatsangehörigkeit – und dann war dort die Flagge der Bundesrepublik Deutschland (schwarz-rot-gold) eingetragen. Was will man mit diesem Eintrag suggerieren? Die BRD hatte und hat nie eine eigene Staatsangehörigkeit und auch kein eigenes Staatsangehörigkeitsrecht!
Bei Anderen stand EU-Bürger. Das ist merkwürdig, wie können Einwohner mit Status „Ungeklärt“ auf Grund fehlendem Verwaltungsakt, Status „Ungeklärt“ wegen fehlender Fortschreibung und Staus „Staatenlos“ wegen Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit durch Weigerung der Feststellung entsprechend dem Teso-Urteil 137 Abs. 22 Satz 2 EU-Bürger sein, wenn der Status „EU-Bürger“ an ein staatsangehörigkeitsrechtliches Treueverhältnis zu einem der Mitgliedstaaten rechtlich gebunden ist?
Auch in diesen Fällen liegt der Betrug auf der Hand.
So haben sich die „Wahlberechtigten“ durch wissentliche oder unwissentliche Falschangaben nicht nur deutsche Dokumente erschlichen, sondern auch Eintragungen in die Wählerverzeichnisse unter Verstoß von § 107 b Abs.1 1 in durch Falschangaben mit der Folge der Aufnahme in das Wählerverzeichnis Überleitung auf § 107a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch in Überleitung zu weiteren Rechtsverstößen und damit Wahlbetrug begangen, sofern teilgenommen strafbar gemacht, was der Unterzeichner hiermit anzeigt.
Auch haben die jeweiligen Einwohnermeldebehörden systematischen Wahlbetrug und damit sich nach § 107b Abs. 1 2 durch Aufnahme von Nichtwahlberechtigen zu denen jeglicher Nachweis der Deutscheigenschaften fehlt und durch systematischen Unterlass der Prüfung der Deutscheigenschaften Personen aufgenommen von denen sie wissen, dass diese nicht wahlberechtigt sind. Erschwert wird dies noch durch div. Schreiben verschiedener Behörden, wo auf diesen Missstand nachweislich hingewiesen wurde die Behörden aber nachweislich abwiegelten und mit Unwahrheiten versuchten ein legitimes Vorgehens vorzutäuschen und mit Zurückweisungen der Einsprüche gegen die Richtigkeit diese strafbaren Handlungen zu schützen und den strafbaren Fortlauf zu gewähren.
Auch soll an dieser Stell nicht unerwähnt bleiben, dass eine angeschriebene Verwaltungen den Eingang Einspruch gegen die Richtigkeit der Wählerlisten bestätigten und diesen nicht zurückwiesen, sprich also rechtlich annahmen.
So wurde der Gesamtumstand durch den Unterzeichner per Fax nachweislich an den Bundeswahlleiter gesendet mit umfangreichen Detaillierungen. Der Bundeswahlleiter hat die eingelegten Einsprüche gegen alle Wählerlisten des Unterzeichners zu keiner Zeit aus sachlichen oder rechtlichen Gründen zurückgewiesen.
Selbiges gilt für den Kreiswahlleiter für die Verbandgemeinde Hermeskeil, auch hier wie bei einigen weiteren Verwaltungen, wiesen die jeweiligen Kreiswahlleiter nicht nur nicht Fristgemäß, sondern gar nicht die ordnungsmäßig eingelegten Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerlisten zurück, was zu einer Annahme führte.
Trotz dessen wird trotz dieser Zustände die Bundestagswahl mit unberichtigten Wählerlisten durchgeführt. Dies stellt klar den Verdacht des systematischen Wahlbetruges dar. Hierdurch wird auch die verfassungsgemäße Ordnung das Grundgesetz z.B. Art. 38 GG nicht nur berührt, sondern offensichtlich die demokratische Grundordnung verletzt und ausgehebelt, weswegen auch eine Ausfertigung an das Bundesamt für Verfassungsschutz geht, eins an die Generalstaatsanwaltschaft und das Bundesverfassungsgericht.
Dem Unterzeichner ist bewusst, dass nicht alle Tatorte im Einzugsbereich der Landespolizei Rheinland-Pfalz liegen, dennoch erwartet der Unterzeichner zur Aufklärung möglicher Straftaten diesen Sachstand aufzuklären, Beweismittel zu sichern und den Fortbestand jener Straftaten zu unterbinden. Hierbei erwartet der Unterzeichner, dass Sie diese Strafanzeige an alle Dienststellen in ganz Deutschland weiterleiten, da sich die Tatorte über ganz Deutschland verteilen.
Der Inhalt dieser Strafanzeige stellt nur einen kleinen Umriss der Gesamtthematik dar. Gerne ist der Unterzeichner bereit, das ganze Problem in seinem gesamten Umfang aufzuzeigen und die hierfür entsprechenden Nachweise zu erbringen.
Was die Wahlhelfer als auch „Wählbaren“ angeht, so leiden diese an demselben Phänomen, der Ungeklärtheit ihres Status und des systematischen unterlass der Prüfung der Erfüllung alles rechtlichen Anforderungen.
So absurd Ihnen dieses hier auch vorkommen mag, der Unterzeichner weist nochmals expliziert darauf hin, dass er seine gemachten Aussagen durch unzählige Beweismittel sowie Zeugen belegen kann.
Der Unterzeichner begehrt mit seiner Anzeige, die Einhaltung des Rechtes, die Einhaltung der demokratischen Grundordnung nach rechtsstaatlichen Grundprinzipien und die Verhinderung der Beseitigung der demokritischen Grundordnung besonders auf in Bezug auf:
Art. 20
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) 1Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 2Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
In diesem Sinne mit freundlichen Grüßen
Rundverteiler:
- Bundesamt für Verfassungsschutz
- Bundesgeneralstaatsanwaltschaft
- Bundesverfassungsgericht
-
Polizei Hermeskeil